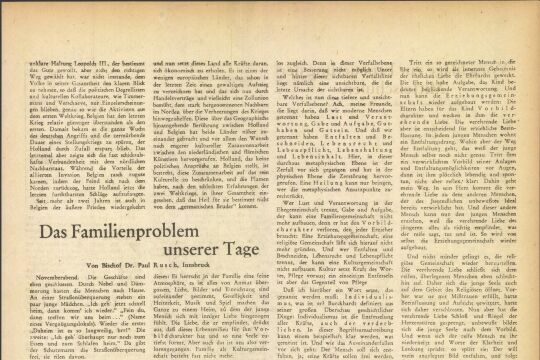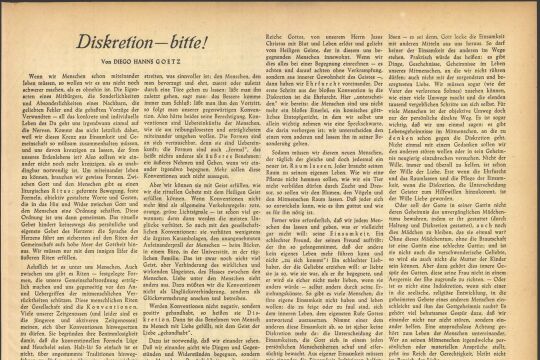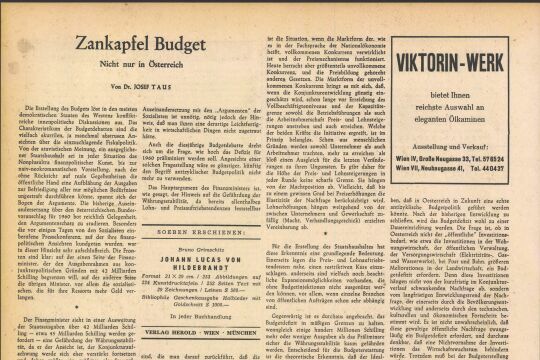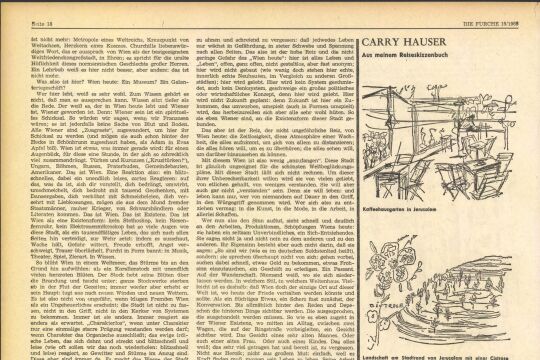Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Exegese von Gemeinplätzen
Der Bürger wagt kaum zu sagen: „Ich bin kein Genie.“ Wie wagt er zu sagen: „Ich bin kein Heiliger“? Beides gehört doch der Ordnung des Absoluten an, muß ihm also widerlich sein. Dennoch hat der Verdacht der Heiligkeit sicherlich etwas Schmerzlicheres für die Eigenliebe und läßt sich schwerer ertragen. Das Genie hat tatsächlich Aussichten, nicht unwiderruflich und endgültig den Idioten beigezählt zu werden; der Heilige nicht. Das ist bekannt.
In der dem Absoluten entfremdeten Sprache des Bürgers indessen muß man immer gefaßt sein auf Überraschungen, Widersprüche, Unsinn und Ungereimtheiten aller Art, bei denen er sich offenbar sehr wohl fühlt, der Außenstehende aber um seinen Verstand bangt. Ich selber muß bekennen, daß ich mich bei meinen Versuchen, etwas Licht in diese Unterwelt zu bringen, häufig darin verliere und am Ende, zum Schrecken meiner Freunde, eine Art Kollaps bekomme.
So etwa bei dem Versuch, den so ausdrücklichen, so bürgerlichen und verständigen Wunsch, kein Heiliger zu sein, mit der Forderung der Heiligkeit der anderen in Einklang zu bringen, besonders der Untergebenen, denn das ist die stille Voraussetzung dieses Gemeinplatzes. Die Heiligkeit wie das Leiden ist für die anderen.
Doch alles ordnet sich aufs schönste. Da nun der Bürger kein Heiliger sein will und sein soll, müssen es andere an seiner Stelle sein, damit er seine Ruhe hat und in Frieden verdauen und rülpsen kann. Das ist die Religion, die für die unteren Stände bestimmt ist und die Voltaire so sehr angepriesen hat, deren Praxis darin besteht, seine Bürde dem Rücken der anderen aufzulasten.
WÄHLE VON ZWEI ÜBELN DAS KLEINERE
Hierüber herrscht Klarheit. Die mitleidigsten Seelen können sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß das Übel des Nächsten immer das k 1 e i n e r e ist und folglich gewählt werden muß. Schon seit langem ist den Psychologen aufgefallen, daß man immer genug Kraft hat, das Leid der andern zu ertragen. '
LEBEN UND LEBEN LASSEN Es wäre kindisch, zu fragen, was der Bürger unter leben versteht. Die Verfasser naturalistischer oder psychologischer Romane, die er mit seinem Vertrauen beehrt, haben zur Genüge bewiesen, daß es in der Verrichtung der natürlichen Funktionen besteht, des Verdauens, Schlafens und Fortpflanzens, wie sie allen Geschöpfen zukommen, vor allem aber darin, viel Geld zu verdienen — der Wesenszug des Menschen, der ihn vom Tier unterscheidet. Indessen war man schon lange vor diesen Erleuchteten überzeugt, daß wer gut zu essen gewohnt ist, gut lebt.
Anders steht es mit l.e b e n lassen. Genügt es denn nicht, daß der Bürger und der Bürger allein lebt?
In der von der seinen so verschiedenen Spräche des Religiösen hat, wie er recht gut weiß, das Wort leben einen anderen Sinn. Was geht ihn das an? Mögen Rappelköpfe oder Hysteriker für ihr sogenanntes Seelenheil leben und dabei verhungern, das ist ihre Sache; daß sie uns Bürger aber für faulende Kadaver ausgeben, ist höchstens erheiternd. Nehmt es nur einmal zur Kenntnis, ihr Pfaffen und Küster, wir sind religiöser als ihr, was schon damit bewiesen ist, daß wir uns einen blauen Teufel um Himmelreich und Seligkeit scheren!
ICH WILL NICHT STERBEN WIE EIN HUND
Man darf sowohl sich wie anderen die Frage vorlegen, weshalb ein Mensch, der wie ein Schwein gelebt hat, nicht wie ein Hund sterben will.
Zunächst: was heißt denn überhaupt, sterben wie ein Hund? Es heißt bekanntlich, diese angenehme Welt ohne Empfang der Sakramente verlassen und sich ohne Federlesens und religiöse Zeremonien auf dem Friedhof verscharren lassen. Der Bürger, der nicht wie ein Hund sterben will, muß also den Priester, wenn möglich den Ortspfarrer, holen, sich mit ihm über die Einkommensteuer unterhalten, über die Intensivierung des Kartoffelanbaus, über Gebißschäden bei Nilpferden oder über die Schulreform bei den Kamtschadalen; durch diesen christlichen Glaubensund Bekenntnisakt erwirbt man das Recht, nach seinem Tod in die Kirche und sodann in Begleitung eines Chorrocks auf den Friedhof getragen zu werden, falls die Familie die Spesen nicht scheut.
All das, ich brauche es wohl nicht erst zu sagen, ist fürs Auge bestimmt. Man stirbt für die Galerie, wenn man nicht wie ein Hund stirbt. Ob Sie es verstehen oder nicht: es geht einzig darum. „Ich kümmere mich nicht um Religion“, sagt der Samenhändler, „aber ich will nicht sterben wie ein Hund.“
Das Ansehen der Firma könnte darunter leiden, falls ihre Kunden zu den Wohlgesinnten gehören. Gehören sie nicht dazu, würde das Firmeninteresse das Gegenteil gebieten, nämlich: zu sterben wie ein Hund; ein seltener Fall in den Kreisen, wo man sich's gut gehen läßt.
Aus dem Werk „Exegese der Gemeinplätze“ mit Bewilligung der Thomas-Morus-Presse im Verlage Herder, Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!