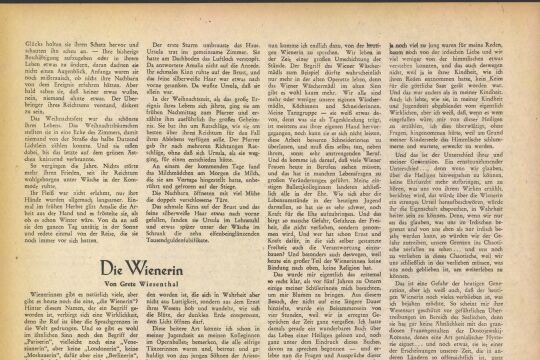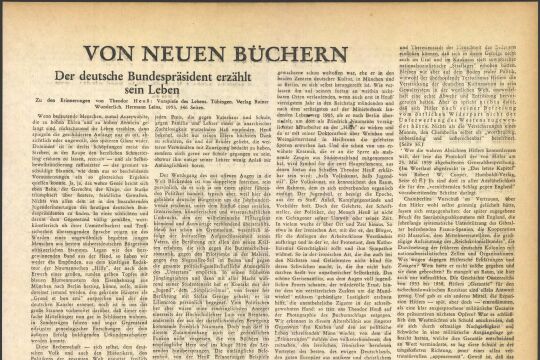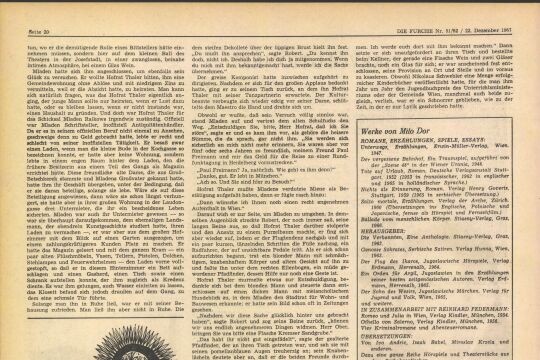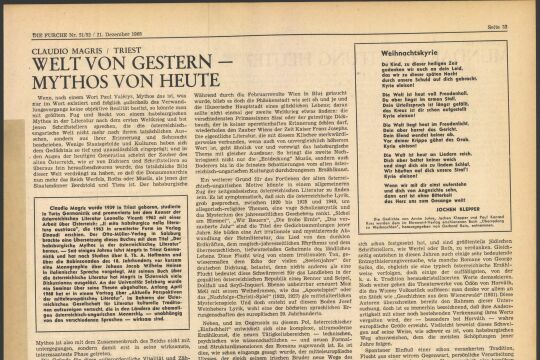Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gab es je „die Wienerin“
Ein neues Buch Ann Tizia Leitichs liegt vor uns. Wir finden in ihm wieder all die besonderen Eigenschaften der kultivierten Autorin, die uns in den vorhergegangenen gefreut hatten: liebenswürdiger Charme, profundes kulturhistorisches Wissen und stilistisches Können. Die drucktechnische Ausstattung ist musterhaft, prachtvoll die selten schönen Bilder. Mit diesem Pauschallob können wir uns gleich dem Inhalt zuwenden. Durch die Seiten dieses Buches gehen viele Wienerinnen, bekannte, berühmte, wenig bekannte, zu Unrecbt vergessene, unbekannte. Die Wienerin, ein vielbesungener, oft gemalter, in Literatur und Dichtung verewigter Frauentyp, ist reichlich 700 Jahre alt, von der Gotik bis ins Heute heraufreichend. In vertikaler Schau umschließt er die Hochgeborene und das Stubenmädchen, Hausfrau und Künstlerin, Dame und Dirndl. Sie alle wären freilich ohne die verschlungene Geschichte dieser alten Stadt nicht denkbar, denn der Mensch ist ein Produkt seiner Umwelt und seiner Herkunft. Wien war aber gar keine Stadt, sondern ein seelischer und geistiger Zustand, der im 19. Jahrhundert kulminierte.
Darum sind drei Viertel des Buches der Wienerin dieses Säkulums gewidmet. In die nach den Stadtdurchbrüchen zur betörend gewordenen, in anmutiger Landschaft hingelagerten Metropole hatte sich etwas von dem 1870 vetnichteten zweiten Kaiserreich geflüchtet. Gewiß war auch, hier wie dort, viel Talmi dabei, indes, man verstand sich aufs Leben, und das nicht nur in den Kreisen Begüterter; nein, auch beim kleinen Mann. Es war ein Dasein, von dem man später sagen konnte, wie Talleyrand vom Ancien regime: wer in ihm nicht gelebt habe, ahne nicht, was die Süßigkeit des Lebens überhaupt bedeute. Das Volk des francisco-josephinischen Wien repräsentierte zusammenfassend ja die Völkerschaften der Monarchie. Sie entsandten in die Kaiserstadt, wie in einen riesigen Schmelztiegel, Amerika nicht ungleich, die schönsten Mädchen und lebenskräftigsten Burschen all dieser unverbrauchten, naturnahen Nationalitäten zwischen Elbe und Pruth. Ein Blick in einen Schematismus etwa zeigt dies deutlich. Jeder .Name ein anderes Herkunftsland: Cornaro, Grimani, Kalergi, Sforza, Bombelles, Hentzi, Gondrecourt, Wrangel, Keyserling, O'Donnell, Taaffe, Maurokor-datos, Jellacic, Bathory, Pomiankowski. Die Träger adeliger Namen finden ihr Gegenstück in den bürgerlichen: Sedlack, Niedermeier, Quapil, Horvath, Kovacs, Nemeth. Katholiken, Calviner, Juden und Mohammedaner lebten hier. Aus dieser Mischung entstand als reizvollstes Produkt die Wienerin, ein Frauentyp, der zu den umschwärmtesten der Welt gehörte. Das Bild von dem küssenden Paar: Deutschmeisterkorporal und Dienstmädchen ist symbolhaft. In ihm müßten hunderte Wiener Hausmeister ihre Großeltern wiedererkennen.
Für die Donaustadt war das Jahr 1918 folgenschwerer als etwa für die Stadt an der Spree. Diese erhielt ihren Bevölkerungszuzug nach wie vor aus Schlesien, der Mark, jene aber nicht mehr aus Podolien, Krain, dem böhmischen Kessel, sondern aus Hollabrunn, Mürzzuschlag, Vöcklabruck. Darum ist die heutige Berlinerin ihrer Großmutter ähnlicher, als es die Wienerin sein kann, deren Eltern schon reine Alpenländler sind. Für das historisch-biologische Phänomen „Wienerin“ gab es keine Wiedergeburt. Aus dem slawisch-madjarischen, germanisch-romanischen Völkerkonglomerat wurde eine rassische Provinz. „Auch die .Hauptstadt' eines Landes kann weit von dem entfernt sein, was eine Metropole ausmacht. Denn dazu genügt es nicht, daß ein Land in ihr repräsentiert ist, es muß d i e Welt in ihr anwesend sein“ (Pawek). Verbäuer-lichung und Technisierung schreiten weiter fort, die eine die Physiognomien nivellierend, die andere die Formen provinzialisierend. Die französische Höflichkeit des Geistes und der Manieren, die im 18. Jahrhundert ihre Vollkommenheit erlangte und im Oesterreich des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts eine Heimstatt gefunden hatte, ist heute durch demagogische Gewöhnlichkeiten fast zerstört. Die Durchdringung der ganz großen Lebensformen, wie sie nur das vortechnische Europa gestalten konnte, ist heute nicht mehr möglich. Kurz gesagt, die Namen blieben (man sehe ins Wiener Telephonbuch), die Physiognomien gingen. Das ist kein gekünstelter Klageruf nach dem Gestern, nur ein soziologischer Tatbestand.
Wenn im Schlußteil des Buches der heutigen Wienerin gedacht wird, ehrt das die Autorin. Die schaffende, liebende und feiernde Wienerin, das Mädchen im Espresso, die Verkäuferin, hat das wohl verdient. Die letzten vier Jahrzehnte hatten an Schwere nicht ihresgleichen in der Stadtgeschichte gehabt. Allein die Leitbilder, denen Jung-Wien eifrigst nachstrebt, stammen von jenseits des Atlantik, scheinen den allenthalben aufliegenden Golddruckjournalen entstiegen. Daher die bestürzende Uniformität weiblicher Gesichter. Daß die Verwandlung der Frau als Regentin der Familie, der Dame des Hauses zur gleichberechtigten Werkbankkollegin eine nicht unbedenkliche Metamorphose war, ist ja unumstritten. Dergestalt wird die Wienerin vielleicht in 20 Jahren sich in nichts mehr, ausgenommen der häufigen Verwendung des Diminutivs, etwa von der Münchnerin unterscheiden, beides Schwestern großer Provinzen. Daß die Anmut der Wienerin in der Sicherheit ihres Gefühls, nicht in der ihres Auftretens, ihres Sich-zur-Geltung-Bringens, in der Tiefe ihrer Substanz und nicht im Umfang ihrer Weltkenntnisse und der Vollkommenheit ihrer Aufklärung lag, das scheint von ihr heute wie vergessen. So betrachtet hat das wunderschöne Buch den Charakter eines Abgesangs, und man greift, wissend, daß es von aller bisherigen Geschichte Abschied zu nehmen gilt, doppelt gern nach ihm.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!