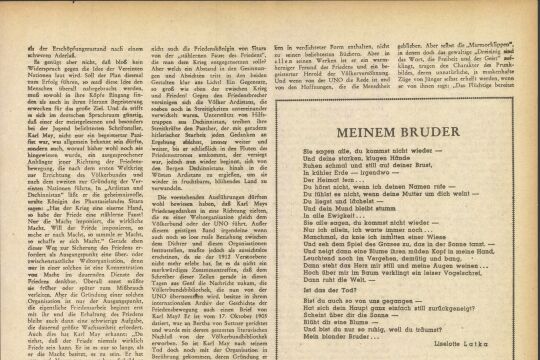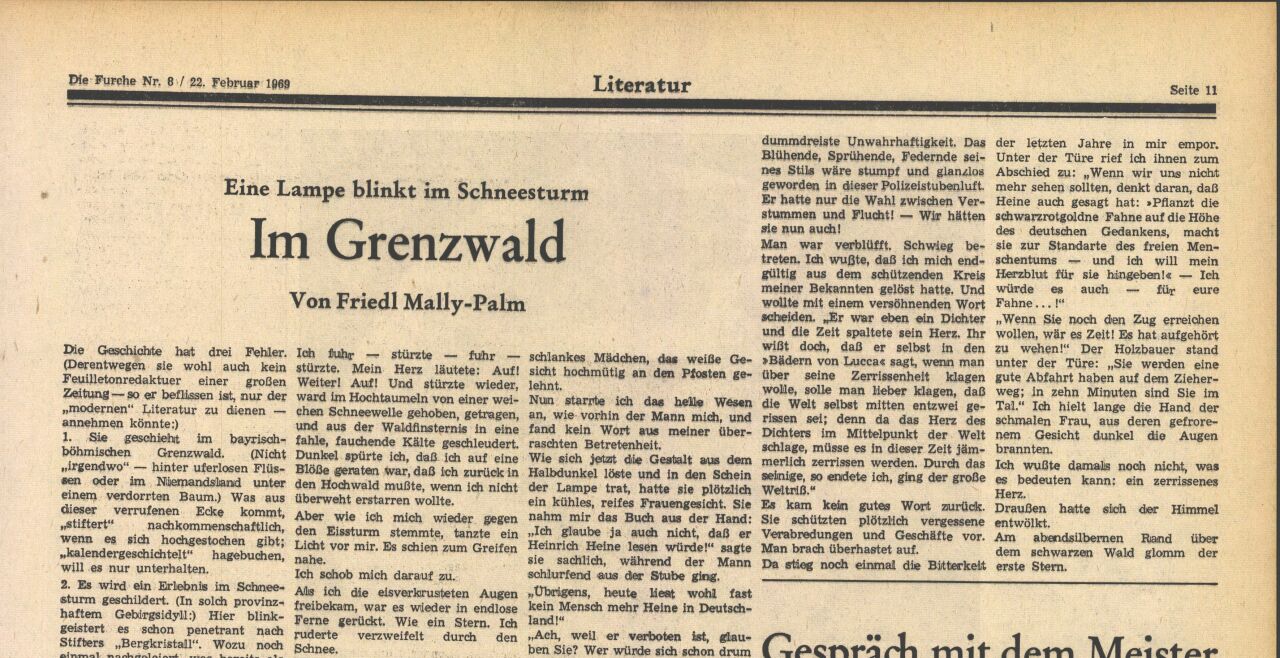
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gesprch mit dem Meister
Er hatte von den Lesungen des alten Gelehrten erfahren und ging, um ihn zu hören, er, der schon viele gehört hatte, aber keinen, den er Meister nennen konnte. Er hatte wie Phaidros die Sucht nach der Kunst der Rede. Er konnte sich begeistern, aber stets war im Grunde seiner Seele eine Saite nicht zum Schwingen gekommen, die Klaviatur seines Hirnes nicht zu Ende gespielt worden. So trug er es, bis er eines Tages zum Meister kam, zum Älteren, der ihn wie der Windigott Boreas anfaßte. Nie zuvor hatte er den Eros im>.Wortei.so empfunden, nie eine Stunde so erlesener Prosa, nie eine so hohe Spannung des Geistes erlebt. Und da erwachte in ihm der Drang, das Erlebte in der Sonne seines eigenen Wortes wiederzugeben. Er schrieb seinem Lehrer einen Brief, denn er fühlte, daß dieser einen Gefährten brauchte, einen, der an seinem Entzücken teilhabe, daß er einen Liebhaber der guten Rede brauchte, um sich selbst zu steigern. Da lud der Ältere seinen Schüler zu Gesprächen ein; dieser wurde sein Jünger und der Verkehr dieser beiden Geister zeugte neues, üppiges Gedankengut, ein Leben im Banne der Wissenschaft und der Kunst. Und der Jüngere lernte vom einen zum anderen Mal die heilige Angst kennen, wie sie Phaidros empfand, als er zu Sokrates kam,, der ihm unter Artigkeiten und werbenden Scherzen über Sehnsucht und Tugend belehrte.
Wenn der Jünger nachts vor seiner kleinen Lampe saß, weil der Geist des Älteren, sein Wort, die Faszination seiner Gestik ihn nicht schlafen ließen, weil die Sehnsucht ihn verbrannte, holte er den „Phaidros“ aus den Buchregalen, den Phaidros, in dessen Rolle er sich hineinversetzt fühlte; denn es war ihm an der Wiege gesungen worden, einmal der Jünger eines Meisters zu werden.
Nahezu täglich gingen sie zusammen, um draußen ihre Gespräche zu halten. Sie legten sich dann unter eine Platane, und der Jünger berichtete seinem Meister, was er von den anderen Klugen, seinen bisherigen Lehrern gehört hatte. Er sprach von den großen Erkenntnissen der Naturwissenschaften, von der Eroberung des Alls durch den Menschen, von dessen Mächtigkeit, durch einen Druck auf einen Knopf die Erde vernichten zu können. Da mednte der Ältere, daß diese Klugen dann wohl auch den Kentauren und den Gott zur Strecke bringen müßte, und fragte seinen Schüler, ob er denn an diese Dinge glaube. Er verwies auf Sokrates, der gesagt hat: „Ich kann noch Immer nicht nach dem delphischen Spruch mich selbst erkennen. Lächerlich also kommt es mir vor, solange ich hierin noch unwissend bin, an andere Dinge zu denken.“ Der Meister nannte diese Weisheiten die „unzierlichen Weisheiten, mit denen man viel Zeit verdirbt“.
Der Jüngere zeigte dann dem Älteren seine Verwunderung darüber, daß er sich kaum aus seiner Stadt hinausbewege, während alle anderen Menschen jede freie Stunde nützten, um ins Weite zu eilen. Und der Lehrer berief sich wieder auf Sokrates, indem er ihn zitierte: „Dies verzeihe mir schon, o Bester. Ich bin eben lernbegierig, und Felder und Bäume wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt.“ In der Tat, es hatte sich der Ältere von dem Jünger überreden lassen; denn ohne daß er es merkte, gelangte er durch seine Führung in die freie Natur hinaus. So stark war die Kraft ihrer Rede.
„Und wenn man dir vorhält“, setzte der Meister fort, „du lebtest nicht mit der Zeit, dann sage den Klugen, sie mögen nicht nur die alten, sondern auch die neuen Bücher aufschlagen und darin lesen, daß nur der Betrachtende ein Gewissen habe, niemals der Handelnde. Der Betrachtende orientiert sich an den Ansichten, daß die Voraussetzung für ein goldenes Zeitalter, dem doch alle nachstreben, die Beschränkung der Bedürfnisse auf ein Mindestmaß sei, daß es richtig sei, seitost bei aller-längster Lebensspanne nicht einmal das nächste Dorf anzustreben, wie die Weisen Chinas es dachten. — Wie also kann man sich entschließen, ohne zu fürchten! Wie kann man überhaupt existieren, ohne zu fürchten! Und hat nicht auch einer unserer gegenwärtigen Staatsführer erklärt, die Menschen seien mit der Not fertig geworden, nicht aber mit Wohlstand und Reichtum? Merkst du nicht, daß alle Menschen Masken tragen, daß sie die Kontinente bereisen und blind und unerfahren bleiben? Denn in der Tat, ich frage dich, junger Knabe, mit den Worten eines zeitgenössischen Dichters: Reicht denn die Zeit des gewöhnlich glücklich ablaufenden Lebens für einen Ritt ins Nachbardorf aus? Der Dichter meint: nein, denn die Entfernung sei ja, genaugenommen, so unausmeßbar groß und die Zeit so unausmeßbar kurz, daß man während eines solchen Rittes vor Erreichung des Zieles, schiene es auch noch so nahe, sehr wahrscheinlich sterben müßte. Das ist der Kern einer Parabel unserer Zeit: Der Großvater, der nicht mehr handelt, sondern nur noch bedenkt.
Siehst du, mein Sohn, ich bin heute schon Großvater, und auch du wirst es einmal sein. Bewahre also stets dein Gewissen, bewahre dir das Denken, und lasse das Handeln für jene, die nicht denken. Da ging der Jünger hin und dachte darüber nach, wieviel Erde der Mensch brauche und ob ihm sein eigenes Dorf genüge.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!