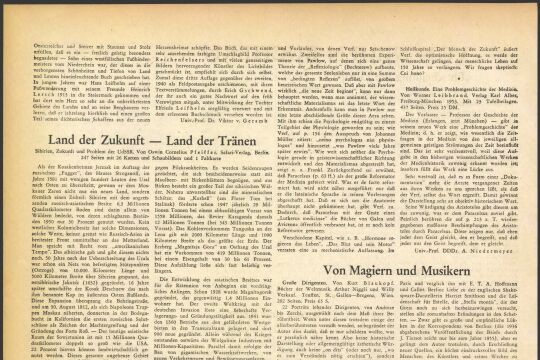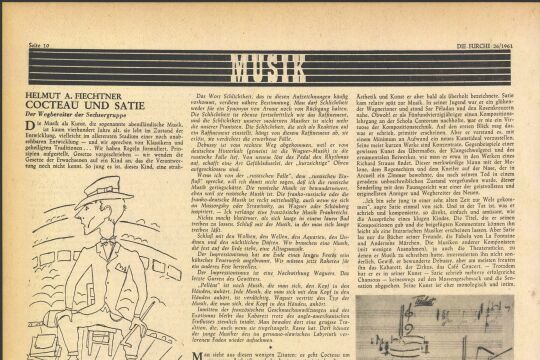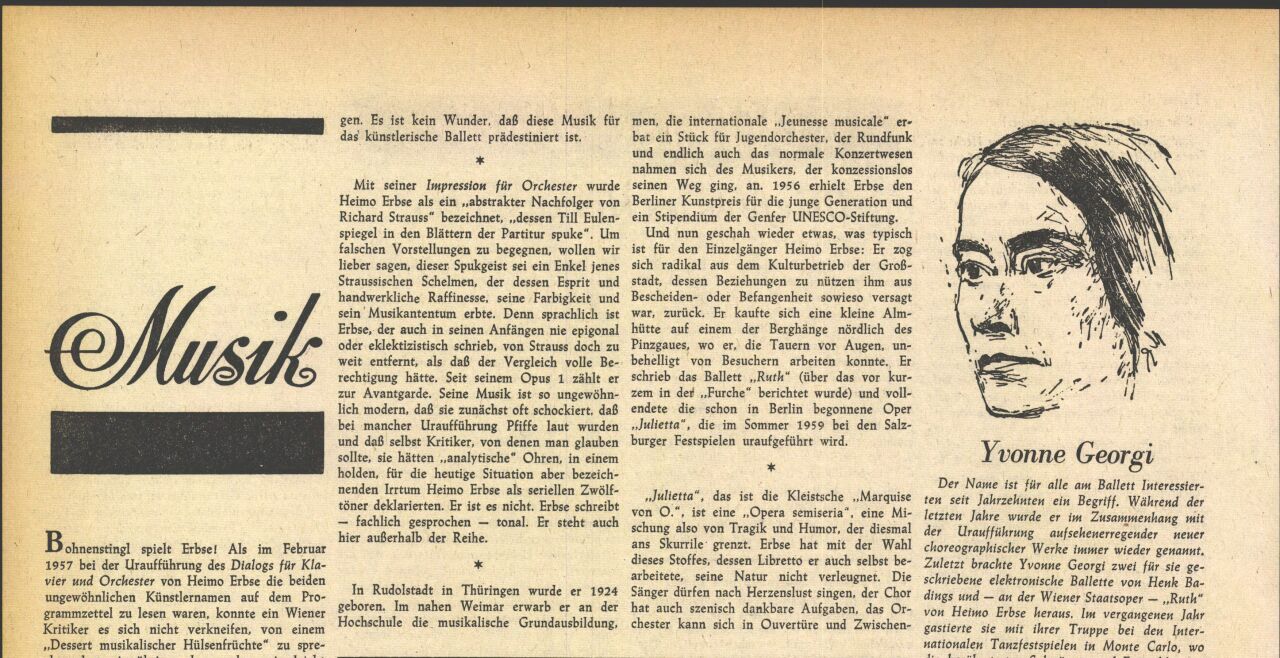
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
HEIMO ERBSE
Bohnenstingl spielt Erbse I Als im Februar 1957 bei der Uraufführung des Dialogs für Klavier und Orchester von Heimo Erbse die beiden ungewöhnlichen Künstlernamen auf dem Programmzettel zu lesen waren, konnte ein Wiener Kritiker es sich nicht verkneifen, von einem „Dessert musikalischer Hülsenfrüchte“ zu sprechen, das er im übrigen als ausnahmsweise leicht bekömmlich bezeichnete. Hans Bohnenstingl, der charmante Salzburger Pianist, dürfte das freundliche Bonmot gewiß nicht übelgenommen haben. Auf keinen Fall reagierte — um im Bilde zu bleiben — der junge Komponist sauer, dem schon von seiner thüringischen Abstammung her die Selbstironie im Blute liegt. Im Gegenteil: Er setzte dem Spiel mit Namen die Krone auf, wenn er berichtet, sein Großvater Erbse, Besitzer einer Gemischtwarenhandlung, habe ein Fräulein Bohne geheiratet und darüber hinaus noch einen Lehrling namens Linse eingestellt, um seinen Kunden ein reichhaltiges Sortiment bieten zu können.
Dieses Histörchen besagt nun gewiß noch nichts über das Schaffen des avantgardistischen Komponisten Heimo Erbse, und doch paßt es in seiner liebenswert heiteren Skurrilität zum Wesen — und eigenartigerweise auch zu vielen Werken — des jungen Mannes. Heiterkeit und Humor eignen zwar vielen Gemälden, Aquarellen oder Graphiken unserer Zeit und machen die bildende Kunst der Moderne gerade dadurch oft reizvoll; in der Musik der letzten Jahre aber besitzen sie Seltenheitswert. Die Klassifikation von Musik in „E“ und „II“, also „ernste“ und „Unterhaltungsmusik“, wie sie von den öffentlichen Kunstinstitutionen geübt wird, scheint nicht verfehlt, wenn wir uns die Programme zeitgenössischer Musik anhören. Zwar mangelt es nicht an Titeln, die Erheiterung versprechen, doch meist sucht man vergeblich nach einem schmunzelnden Gesicht im Publikum, weil keiner den musikalischen Spaß verstanden hat.
.
Mit ganz wenigen zeitgenössischen Komponisten bildet in dieser Hinsicht Heimo Erbse eine Ausnahme im Kreise der Schöpfer „ernster“ Musik unserer Tage, und wenn sein Humor auch nicht so drastisch und von ganz anderem Charakter ist, als etwa die Deftigkeit Hindemiths in der Marschpersiflage der „Sinfonia serena“ oder der trockene Witz Strawinskys in der Zirkuspolka (von Orff und anderen ganz zu schweigen), so mag doch die heitere Grundhaltung Erbses Anlaß sein, daß seine Werke immer häufiger aufgeführt werden.
Neben Liedern, Klavierkompositionen und Kammermusik ist da vor allem die Sinfonietta giocosa zu nennen: In dem dritten Satz, der die altertümliche Bezeichnung „Tempo di Minuetto“ trägt, bringt die Klarinette, von den Streichern pizzicato oder mit kurzen Glissando-Tupfern nur andeutend begleitet, das beschwingte Thema; in den Variationen dieses Menuetts schlagen gestopfte Blechbläser einen „beat“, der an zünftigen Jazz erinnert. Auch das Capriccio für Streicher, Klavier und Schlagzeug oder das eingangs erwähnte Klavierkonzert verwenden gelegentlich Jazzelemente. Rhythmisch nehmen diese unproblematischen Spielstücke den Hörer sofort gefangen, jedoch nicht durch billige Ostinati, die so leicht beim Publikum einen Trancezustand herbeiführen. der gegen das melodische und harmonische Geschehen taub macht. Erbses Rhythmik lebt vom beständigen Wandel, unmerklich wechselnd zwischen tänzelndem Schweben, beschwingtem Wiegen oder harten Synkopenscblä-
gen. Es ist kein Wunder, daß diese Musik für das künstlerische Ballett prädestiniert ist.
Mit seiner Impression für Orchester wurde Heimo Erbse als ein „abstrakter Nachfolger von Richard Strauss" bezeichnet, „dessen Till Eulenspiegel in den Blättern der Partitur spuke“. Um falschen Vorstellungen zu begegnen, wollen wir lieber sagen, dieser Spukgeist sei ein Enkel jenes Straussischen Schelmen, der dessen Esprit und handwerkliche Raffinesse, seine Farbigkeit und sein Musikantentum erbte. Denn sprachlich ist Erbse, der auch in seinen Anfängen nie epigonal oder eklektizistisch schrieb, von Strauss doch zu weit entfernt, als daß der Vergleich volle Berechtigung hätte. Seit seinem Opus 1 zählt er zur Avantgarde. Seine Musik ist so ungewöhnlich modern, daß sie zunächst oft schockiert, daß bei mancher Uraufführung Pfiffe laut wurden und daß selbst Kritiker, von denen man glauben sollte, sie hätten „analytische“ Ohren, in einem holden, für die heutige Situation aber bezeichnenden Irrtum Heimo Erbse als seriellen Zwölf- töner deklarierten. Er ist es nicht. Erbse schreibt — fachlich gesprochen — tonal. Er steht auch hier außerhalb der Reihe.
In Rudolstadt in Thüringen wurde er 1924 geboren. Im nahen Weimar erwarb er an der Hochschule die musikalische Grundausbildung,
an mitteldeutschen Bühnen die ersten praktischen Erfahrungen als Opernregisseur. 1950 siedelte Heimo Erbse nach West-Berlin über. Hier wurde er bald Meisterschüler Boris Blachers, mit dessen Kompositionen Erbses Orchester- und Bühnenwerke die Lichte des Orchestersatzes, die Farbigkeit der Instrumentation, die Nervosität der Melodik und die knappe Formulierung gemeinsam haben, ohne daß er etwa Blacher kopiert. In Berlin ging während der Festwochen 1952 die Kurzoper „Fabel in C“ in Szene, hier führten die Philharmoniker seine Orchesterwerke auf, hier bestand Erbse erfolgreich die Angriffe einer anspruchsvollen Kritik. Professor Schuh stellte ihm dankbare Aufgaben als „Hauskomponist“ des damals von ihm geleiteten Theaters am Kurfürstendamm, woraus Erbse neue Aufträge erwuchsen, wie Kompositionen für Kulturfilme, in denen die Musik echte dramaturgische Funktionen innehatte. Bald wurde man in Westdeutschland, Oesterreich und im fremdsprachigen Ausland auf Heimo Erbse aufmerksam. Seine Werke wurden von den Veranstaltern zeitgenössischer Musikfeste angenom men, die internationale „Jeunesse musicale" erbat ein Stück für Jugendorchester, der Rundfunk und endlich auch das normale Konzertwesen nahmen sich des Musikers, der konzessionslos seinen Weg ging, an. 1956 erhielt Erbse den Berliner Kunstpreis für die junge Generation und ein Stipendium der Genfer UNESCO-Stiftung.
Und nun geschah wieder etwas, was typisch ist für den Einzelgänger Heimo Erbse: Er zog sich radikal aus dem Kulturbetrieb der Großstadt, dessen Beziehungen zu nützen ihm aus Bescheiden- oder Befangenheit sowieso versagt war, zurück. Er kaufte sich eine kleine Almhütte auf einem der Berghänge nördlich des Pinzgaues, wo er, die Tauern vor Augen, unbehelligt von Besuchern arbeiten konnte. Er schrieb das Ballett „Ruth“ (über das vor kurzem in det „Furche“ berichtet wurde) und vollendete die schon in Berlin begonnene Oper „Julietta“, die im Sommer 1959 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wird.
„Julietta“, das ist die Kleistsche „Marquise von O.“, ist eine „Opera semiseria“, eine Mischung also von Tragik und Humor, der diesmal ans Skurrile grenzt. Erbse hat mit der Wahl dieses Stoffes, dessen Libretto er auch selbst bearbeitete, seine Natur nicht verleugnet. Die Sänger dürfen nach Herzenslust singen, der Chor hat auch szenisch dankbare Aufgaben, das Orchester kann sich in Ouvertüre und Zwischen spielen ausleben. Der Regisseur muß psychologische Feinarbeit leisten, denn er muß drei verschiedene Darstellungsebenen glaubhaft machen: die Groteske der hämischen Spießer aus Juliettas Umwelt, die tragikomische Situation des Vaters jenes während einer Bewußtlosigkeit der Marquise gezeugten „Besatzungskindes", und endlich den ganzen Ernst der Titelfigur mit dem allgemein gültigen Mutterproblem, da Julietta ja das unter so makabren Umständen empfangene Kind trotz Not und Versuchung und Schande liebgewinnen und zur Welt bringen muß. Wir dürfen auf die Uraufführung gespannt sein!
Der Komponist hat das Werk abgeschlossen. Heimo Erbse hat sich in seine Einsiedelei zurückgezogen. In seiner Almhütte sitzt er am mühselig hinauftransportierten Klavier und arbeitet an neuen Werken. Wird es ein Festmarsch für die Hundsdorfer Feuerwehrkapelle, ein Tribut an das dörfliche Musikleben seiner neuen Heimat? Zuzutrauen wär’s ihm!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!