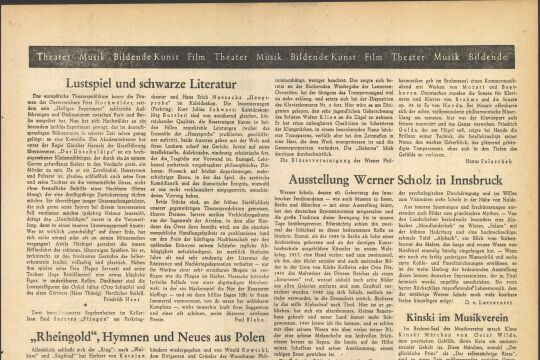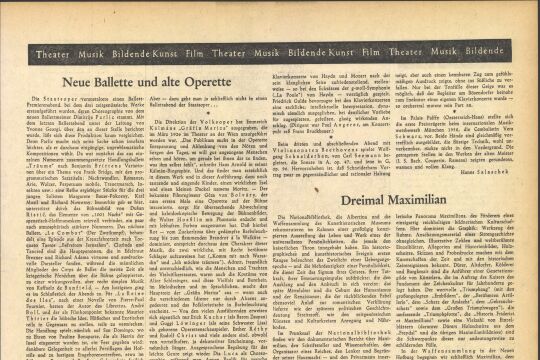Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Große und kleine Symphonie
Im 6. Konzert des Zyklus „Die große Symphonie“ hatte der 71jäh-rige Sir John Barbirolli anscheinend seine Kräfte bis nach der Pause aufgespart, um sie hier um so temperamentvoller einzusetzen: bei Beethovens 5. Symphonie, die wir schon lange nicht so intensiv und klangprächtig gehört haben. Er ließ sie in großer Besetzung spielen, und das (im Programm nicht genannte) Orchester der Wiener Symphoniker zeigte sich am Donnerstagabend in Hochform (es gab keinen einzigen „Gickser“ und keinen beiläufigen Einsatz) und jedem anderen Orchester ebenbürtig.
Nicht weniger in seinem Element war Sir John bei der Interpretation von Händeis „Wassermusik“, aus deren etwa 20 Teilen Sir Herbert Hamilton Harty (1879—1941) sechs Stücke ausgewählt und „orchestral bereichert“ hat, ganz im Geschmack seiner Zeit, aber in der Farbigkeit und Fülle der Instrumentierung dem Geist Händeis keineswegs fremd. Dem entsprach auch die Interpretation Barbirollis, der vor allem die Streicher sotto voce spielen ließ und auch für effektvolle Kontraste im Dynamischen sorgte. Zwischen diesen beiden Meisterwerken behauptete sich das 3. Klavierkonzert Bila Bartöks aus dem Jahre 1945 bestens. Bartöks letztes vollendetes Werk unterscheidet sich von seinen früheren Kompositionen, besonders Von dan Klavierkonzerten I und II, sehr wesentlich durch seine Ausgeglichenheit und harmonische Einfachheit, die bis zum Gefälligen reicht. Bartök, selbst ein ausgezeichneter Pianist, hat dem Solisten einen großartigen Part geschrieben, dessen Schwierigkeiten zwar eminent, aber stets sinnvoll sind. In den beiden raschen Ecksätzen brillierte der junge amerikanische Pianist Malcolm Frager, Träger eines halben Dutzends internationaler Preise, durch Virtuosität, energisch-kraftvollen Anschlag, Temperament und Präzision. In der Zwiesprache mit dem Orchester im „Adagio religioso“ wollte sich aber nicht jene entrückte Stimmung einstellen, wie wir sie bei der Wiedergabe des mittleren Teiles schon wiederholt erlebt haben. Daran mag u. a. auch der merkwürdig färb- und glanzlose Ton des Stein-way-Flügels in seiner mittleren Lage schuld gewesen sein. Lebhafter und langanhaltender Beifall für alle Ausführenden.
*
Im Großen Sendesaal des Wiener Funkhauses dirigierte Thomas Ungar ein Konzert des ORF-Symphonieorchesters, das auch im 1. Programm
gesendet wurde. Der bekannte Schönberg-Schüler und DDR-Komponist Hanns Eisler hat verschiedene Stadien durchlaufen: von der Esoterik früher Zwölftonkompositaonen bis zum proletarischen Massenlied. In seiner III. Suite für Orchester op. 26 zeigt sich Eisler (1898—1962) von der neobarocken und motorischen Seite. Allein schon die Instrumentation (Klarinetten, Saxophone, Trompeten, Posaune, Schlagwerk, Banjo, Violoncelli und Kontrabässe), mehr aber noch die Diktion ist dem Vorbild Kurt Weills verpflichtet. Das ist eine gekonnte, gutklingende, rhythmisch prägnante und melodiöse Musik, der nur im getragenen Mittelteil (Intermezzo) die Luft ein wenig ausgeht.
Weniger profiliert ist die Sinfonie in vier Sätzen op. 23 von Heimo Erbse (Jahrgang 1924). Zahlreiche große Septimen und kleine Sekunden, Nonenakkorde und dichte Stimmführung färben die Harmonik dissonant. Zwar sind Dissonanzen, wie wir wissen (und wie uns auch im Programm versichert wird), zum musikalischen Alltagsrequisit geworden, aber in dieser Partitur sieht man ihre Notwendigkeit nicht ein. Viele Akkorde, ja ganze Passagen, klingen nur häßlich (was man von der Musik etwa eines Alban Berg, die harmonisch viel kühner ist, nie behaupten kann). Man sieht, gewissermaßen, die Notwendigkeit der gehäuften Mißklänge nicht ein, zumal die Struktur dieser vier glücklicherweise kurzen Sätze relativ einfach ist. Dann schon lieber, im Interesse der Ordnung, Zwölftonmusik. Aber Erbse hat sich leider im kompositionstechnischen Niemandsland niedergelassen...
In beiden Werken bewährte sich der Gastdirigent bestens. Er heißt Thomas Ungar, war einer der künstlerischen Leiter der nach dem Ungarn-aufstand in Wien gegründeten Phil-harmonia Hunganica und ist seither in der BRD tätig, gegenwärtig als Generalmusikdirektor in Freiburg i. Br. — Woran es gelegen haben mag, daß das von Wolfgang Schneiderhan untadelig und ausdrucksvoll gespielte Violinkonzert von Brahms nicht ganz „ankam“? An der mangelnden Routine des jungen Orchesters, am Saal, an ungenügendem Kontakt aller mit allen? Merkwürdiger Fall. Zumal Mängel und Fehler im einzelnen nicht aufzuzeigen sind. Anscheinend braucht das Brahms-Konzert, um voll zur Wirkung zu kommen, die Akustik und das Ambiente des Großen Musikvereinssaales ...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!