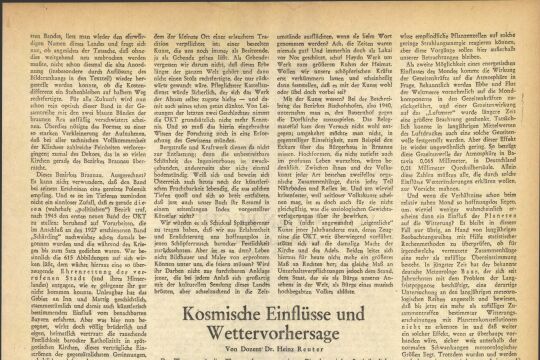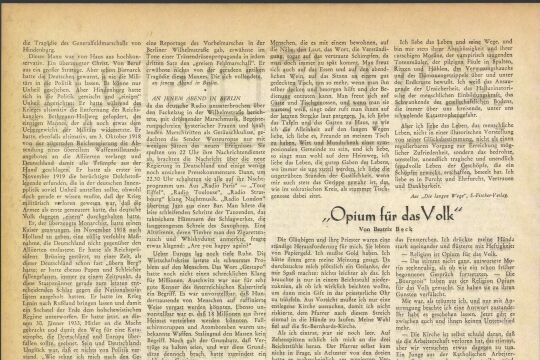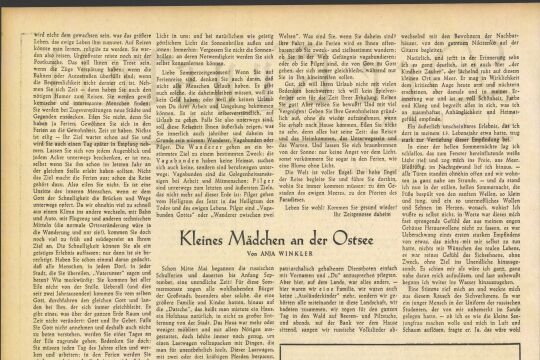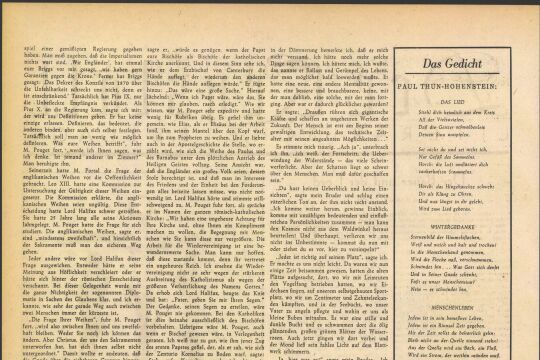Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hocligelokte Chinesen
Ich habe mich oft gefragt, woher meine Sympathie für Chinesisches stamme, die sich bis zur Liebe steigert. Sind es die azurblauen Götzenbilder, ist es ein graziös in der Hand gehaltener Fächer? Oder die schwarze Schnur eines Zopfes, der sich vom Hinterhaupte herabringelt? Ist es die leise schwingende Rundung einer edlen Porzellanschale? Gewiß hat sich all das unauslöschlich in mein Gedächtnis geprägt. Doch heute will ich von dem bewegten, dem täglichen China reden, von den Lauten, die aus einer der bunten, lebenerfüllten Gassen Kantons steigen. Die weiße Rasse? Ich habe mehr als genug von ihr. Der Inder? Ihm eignet etwas naturhaft Fruchtbares, allzu anhänglich ist sein Wesen. Seine milden Augen scheinen stets einen Vorwurf auszusprechen. Es ist, als ob sie immer fragten. Ihre verschwiegenen Klagen dringen bis an unser Herz. Wie anders hingegen ist der Chinese schon im ersten Augenblick einer BekanntschaftI Seine Anteilnahme ist -wach und impulsiv, besonders wenn ich an Singapore zurückdenke. Für ihn gibt es kein Morgen. Er strömt Wärme, eine lebhafte und stets gegenwärtige Begeisterung aus. Betrachtet nur die Horde der Schiffer, die um einen großen Ozeandampfer wimmelt, wenn das Schiff in Schanghai oder Hongkong vor Anker geht! In diesem lärmenden Leben, in dieser kindlichen Freude, die bis zum Himmel hinaufzureichen scheint, könnte man von einem tausendköpfigen Schwann von Möwen sprechen, die sich mit gierigem Schrei um einen toten Fisch balgen. Wie soll man diese Menschen nur verstehen? Besuchen wir das Theater, vielleicht hilft es uns.
Auf der Bühne ist man niemals privat. Zwischen den Kulissen gibt es kein Zivil. Mit all seiner Klugheit, all seinem Gefühl, kurz: mit dem ganzen Herzen ist man bei der Sache. Und das ist notwendig, man darf seine Rolle keine Sekunde lang vergessen. Selbst wenn es die Rolle eines Statisten ist, so hat man doch immer daran zu denken, daß ein Stück unbedingt auch diese winzige Rolle braucht. Auf der Bühne gibt es nichts überflüssiges, nichts, was man außer acht gelassen hätte. Es ist anders als im täglichen Dasein mit seiner Langeweile. Nichts ist hier Gewohnheit, nichts monoton oder phlegmatisch. Immer erklingt ein neues Stichwort. Unsere Rolle, sei sie gut oder spärlich, ist weit wie ein ewig rollender Teppich, der unseren Füßen entgleitet und uns immer wieder zur Balance zwingt.
Ein solcher Schauspieler ist der Chinese. Immer steht er auf der Bühne. Immer ist er wach, immer ergriffen von fast verzehrender Anteilnahme. Mag es sich um einen Bankherren, einen Maurer, einen Rikschakuli, um einen Schiffer mit kleiner Familie handeln, oder auch um einen Kellner im Gasthof, um eine ehrbare Mutter oder um ein Kind, immer ist der Chinese auf den Brettern, und er spielt seine Rolle so gut, als es ihm nötig scheint. Er hat den festen Willen, sich so gut wie möglich aus einer Angelegenheit zu ziehen. Er ist auf die Sekunde da, er versäumt kein Stichwort. Nehmen wir zum Beispiel eine Beerdigung: wie langweilig und eintönig wäre sie, wenn es nicht ungezählte Möglichkeiten gäbe, dabei zu profitieren und alles auszunützen, was sich zwangsläufig ergibt. Man hat Gelegenheit, sich mit allen Arten des Kummers, mit vollem Magen, mit vollem Herzen und vollen Lungen auszugeben. Niemand ist da, der nicht seine bescheidene Sonderleistung im Chor der Klagen darbrächte. Es folgt alsdann die geradezu festliche Zeremonie des Beileids, bei der ein jeder voll auf seine Kosten kommt. Aber dann plötzlich ein frischer Wind in den Dunst der Bekümmerung, wenn die Frage der Erbschaft angeschnitten wird. Man höre sich die zwei Frauen an, die sich nach Herzenslust streiten. Monate würden gebraucht, all ihre Schimpfworte zu sammeln.
Beseht euch den Unterschied zwischen den Eremiten der guten alten Zeit in China und ihren indischen Berufskollegen. Die Inder scheinen wirklich zu meditieren. Die Chinesen dagegen sind wie ein mächtiger, summender Teekessel über dem Feuer. Sie gleichen in der Ecke, in der sie es sich bequem gemacht haben, einer schnurrenden Katze. Mit einem kleinen, flinken Auge blinzeln sie unmerklich den Besucher an und machen sich über ihn lustig. Glaubt ihr denn tatsächlich, diese Bilder, diese Zeichnungen, sie seien nichts anderes als chinesische Tusche und Wasser? Atmet in ihnen nicht Beschaulichkeit, eine ganz lebendige und gegenwärtige Lebensart? Ein Chinese sucht nichts hinter der Natur. Er erlebt sie, ohne Hintergedanken.
Ich erinnere mich an einen Abend in Tientsin; es war mein letzter, in einer Umgebung, wie sie trostloser kaum zu sehen ist. Die Stunde des Sonnenuntergangs war gekommen. Ich meine, daß die Natur mit ihren verfügbaren Mitteln sich besonders wenig beim Sonnenuntergang anstrengt. Aber an diesem Abend war es anders. Ich konnte mir lange nicht denken, wieso denn eigentlich. Doch da lag an der Landungsbrücke ein Boot von Leuten, die mit ihrem Schiff Wassermelonen auf den Markt bringen, nachdem sie vor abends den Unrat aus den Abtritten mit dem gleichen Schiff fortgefahren hatten. Soeben waren die Bootsmänner mit dem Abendbrot fertig und vollauf befriedigt. Nun sangen sie der Reihe nach leise Lieder. Den Takt dazu schienen die Eßstäbchen zu schlagen. Noch heute, nach langer Zeit, höre ich deutlich den Rhythmus der feinen Stäbchen am Rande der hauchdünnen Porzel-lanschälchen. Es ist gewiß, daß keiner dieser Sänger den Sonnenuntergang bemerkte. Aber so viel ist sicher: ohne diese braven Burschen mit ihrem vollen Magen, mit ihrem Gesang, ohne ihre zart klingenden Eßstäbchen wäre es kein Sonnenuntergang gewesen. Oder er wäre der Natur nicht so gut gelungen wie an diesem längst vergangenen Abend in Tientsin. ... ,
Berechtigte Übertragung von Helmuth de Haas
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!