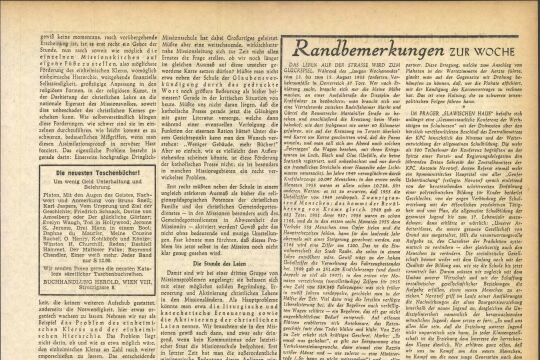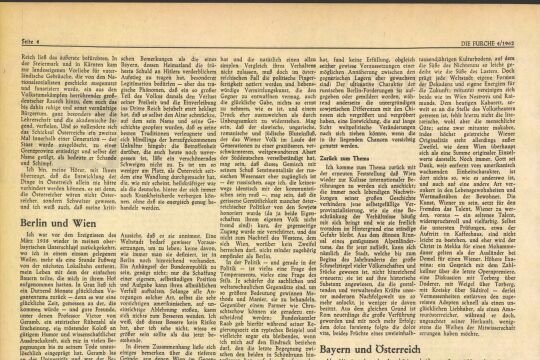Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
IM STREIFLICHT
ArIT dem Einzug ins neue Opernhaus am Ring wird auch die Frage nach dem weiteren Schicksal der Volksoper aktuell. Wird man mit deren Repertoire und Ensemble ins Theater an der Wien übersiedeln, sobald dieses frei wird? Das scheint kaum möglich, da das letztere einer gründlichen .— übrigens sehr kostspieligen — Ueberholung bedarf, um den baupolizeilichen Vorschriften zu genügen. Somit fiele dieses schöne, zu einem intimen Mozart-Theater prädestinierte Haus für mindestens ein Jahr aus. Bliebe noch der Redoutensaal mit seiner zweifelhaften Akustik und seinen ungünstigen Proportionen: weder für die Volksoper noch fürs Theater an der Wien ein Ersatz. Also doch die Volksoper als zweites Theater neben dem großen Haus? Daß das Gebäude von außen häßlich-verwahrlost und von innen wenig attraktiv ist, weiß jedermann. Es geht aber weniger um die Fassade als um das Repertoire. Gegenwärtig umfaßt dieses je ein Dutzend klassischer Opern und Operetten, je ein halbes Dutzend Spielopern und Ballette sowie drei neuere Opernwerke. Diese Uebersicht zeigt die Lücken und die Disproportion. Bevor wir nicht hierzu programmatische Aeußerungen, im doppelten Wortsinn, hören, möchten wir uns zu dem Komplex nicht äußern. Auf der Linie des „Kuhreigens“ sollten die Neuinszenierungen jedenfalls nicht liegen. Daran hat heute kaum noch jemand eine Freude.
A LS am Freitag, den 4. April 1941, im Steh- parterre der Wiener Staatsoper Zuhörer durch taktartiges, auf Fußballplätzen geschultes Pochen ihr Mißfallen an der Oper „Johanna Balk“ von Rudolf Wagner-Regeny kundgaben, hat das damalige Regime die Polizei geholt und die Demonstranten mit Gewalt aus dem Hause gezerrt. Niemand von der Presse wagte es, bei den damaligen Verhältnissen davon zu berichten, ja — mit einer Ausnahme — auch nur von Mißfallenskundgebungen zu schreiben. Das nannte man damals Kunsterziehung. — Vor einiger Zeit hat wieder jene Gattung Menschen, deren Argument die Gewalt ist, bei Nacht die Freiluftausstellung im Wiener Stadtpark „besucht". Mehrere der Plastiken, deren Aufstellung als Förderung ringender Künstler vom Kulturamte der Stadt Wien veranlaßt wurde, sind dabei schwer beschädigt, eine völlig zertrümmert worden. Die Inschrift einer Plastik „Die Muttersau" wurde „witzigerweise" dem weit davon entfernten Denkmale Schuberts umgehängt. Es waren kräftige Männer. Sie konnten auch Spitzhacken handhaben. Als Antwort wurde dann verlautbart, daß die Freiluftausstellung sozusagen freiluf’ringkampfmäßig durch Rollkommandos der Polizei dauernd behütet wird. Es gab eine kleine Lokalnotiz irgendwo; so wie man über einen Verkehrsunfall berichtet. Und in Radio Wien, etwa eine Woche später, eine sommerlaue Ansprache im „Echo des Tages"; mit einer verbrämten Einladung an die mittlerweile auch flugblattwerfenden Spitzhackenmeister zu einer „Diskussion". Und dann Schwamm drüber. — Wir meinen, daß die Zerstörung und Verstümmelung von Kunstwerken keine Argumente sind. Wer gegen etwas ist, der möge sich dazu bekennen, und zwar bei Tageslicht. Auch möge er bedenken, daß man über pulverisierte Plastiken nicht mehr diskutieren kann. So setzt man sich nämlich, als Gewalttäter, auf jeden Fall ins Unrecht!
P ROHE Botschaft von der Filmleinwand her- - ab: Amerikaner haben einen Kulturfilm über die „Kunst der weißen Hengste" unserer spani- . sehen Reitschule gedreht und dabei vor Oesterreichs Traditionsreichtum eine in Bild und Ton überraschend gelungene Verneigung gemacht. Das Filmehen läuft, mit Josef Meinrad als Sprecher des wortgetreu übersetzten, schönen und wohlinformierten amerikanischen Originaltextes, als Beiprogramm zu dem großartigen englischen Mount-Everest-Film. Er enthält mehr Kenntnis und Achtung vor Oesterreich als ein Dutzend heimischer Johann-Orth- und Johann- Jodler-Filme zusammen.
p IN Film, der für eine einzige Vorführung zusammengestellt wurde, früher nie aufgeführt worden ist und auch nie mehr aufgeführt werden wird, bildete die Spezialität der kürzlich zu Ende gegangenen Berliner Filmfestspiele. Er besitzt keinen Titel, und eigentlich ist es auch gar kein Film gewesen, sondern eine Szenenfolge: die Zusammenstellung der unmoralischen, grausamen, unappetitlichen, brutalen Filmszenen des Jahres, die der Schere der freiwilligen Selbstkontrolle der deutschen Filmwirtschaft zum Opfer gefallen sind. Pausenlos lief über die Leinwand, was diese Zensurstelle für sittengefährdend, Rassenhaß oder Militarismus fördernd, für religionsentfremdend, für brutal und politisch untragbar hält. Wie man hört, waren die ausländischen Journalisten (ihnen allein wurde der „Film“ vorgeführt) von dem Gezeigten tief beeindruckt. Und das ist immerhin verwunderlich, denn „wir Ausländer“ ohne Filmselbstkontrolle durften diese Szenen ja das ganze Jahr über im Original genießen, allerdings nicht als einmaliges grausliches Ragout, sondern auf mehrere Mahlzeiten verteilt. Ob sie dadurch genießbarer, bekömmlicher waren?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!