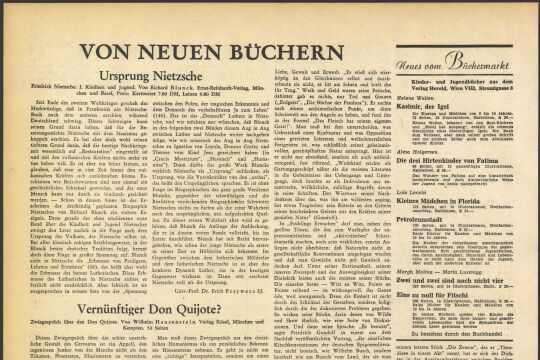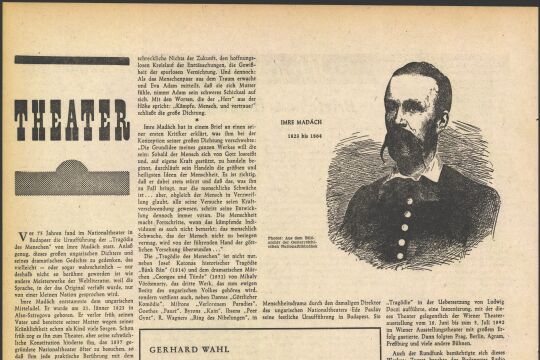Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ist so das Leben?
Frank Wedekind, dessen hundertstem Geburtstag wir uns nähern, hat als „Moralist mit umgekehrten Vorzeichen“ in seinen Werken mit leidenschaftlichem Ungestüm die Konventionen unter der Decke der bürgerlichen Moralität berannt. Mit Fug hat er sich einen Moralisten genannt, insofern er geheuchelte Tugenden und nicht gelebte Moral bloßstellte. Es war ein entscheidender Antrieb seines Dichtens, eine mit dem Ersten Weltkrieg auch äußerlich zu Ende gehende Welt zu überwinden. Die kühne Illusionsfeindlichkeit seiner Szenenführung, die Peitschenschläge seiner von allem Schmuck befreiten Sprache trafen damals ins Schwarze. Aber im Juli 1904 schrieb er an eine Freundin: „Mit der Literatur bin ich fertig. Die halsstarrige Abneigung des großen Publikums gegen mich würde ich noch in den kommenden zehn Jahren... kaum besiegen.“ Er hat recht behalten; das so tödlich erschrockene Theaterpublikum hat es diesem großen Provokateur nie verziehen, daß er Zeit seines Lebens Anstoß erregt und Unruhe gestiftet hat.
Klage voll bitterer Selbstironie darüber, daß er als Dichter verkannt und nicht ernst genommen wurde, sollte sein 1901 enstandenes Schauspiel „König Nicolo oder So ist das Leben“ sein. Man braucht in den Reden König Nicolos nur jeweils statt König Dichter zu setzen, und jedes Wort paßt auf Wedekind selbst. „Nur kein Gelächter!“, lauten die ersten Worte des Prologs. Wedekinds Aufforderung an die Zuschauer ist moralisch: Sie sollen sich der beleidigten Menschenwürde wieder bewußt werden, die in ihnen allen lebt und die sie entthront haben. Was Wedekind demonstrieren will, ist das Königliche, das Dichtertum als Zeugnis der Auserwähltheit und der Verdammnis zugleich. Dichtung als reine Poesie, von der romintischen Art, die aus dem
Gegensatz zur Welt, wie sie ist, ihren Zauber und ihre Dämonie bezieht.
König Nicolo von Umbrien wird von einem Schlächtermeister entthront, muß sich als Schweinehirt, als Damenschneider verdingen, wird wegen Majestätsbeleidigung ins Gefängnis geworfen, tritt als Charakterdarsteller in einer Königsposse auf und endet als Hofnarr des neuen Bürgerkönigs. Schließlich bekennt er, daß er Nicolo sei, aber niemand glaubt ihm; er hat keine Beweise und stirbt als Narr.
Aus der kaum verschleierten Klage und Anklage wird ein seltsam doppelbödiges Spiel, wächst ein überpersönliches Spiegelbild des Schicksals „königlicher“ Menschen, die als Gezeichnete, von sich Besessene durch die Welt der Normalen gehen müssen. Einer ganz aufs Praktische eingestellten Gesellschaft muß Wedekinds qualvolles Gelächter wieder ins Ohr dröhnen.
„König Nicolo“ ist kein starkes Stück. Es gibt viele Werke Wedekinds, die das Leben unmittelbarer, hinreißender gestaltet haben. Aber das dichterische Urbild für das Gaukelspiel des Lebens, das „uralte Akrobatenstück, sich selber auf den Kopf zu steigen“, gerät doch zu einiger Erschütterung. Dabei war die Aufführung im Volkstheater, als Beitrag zu den eben angelaufenen Wiener Festwochen gedacht, keineswegs immer mitreißend. Günther Lüders (als Gast) in der Titelrolle überzeugte am stärksten in der Szene der „Elendenkirchweih“ und in der Königsposse. Elisabeth Schwarz (als Gast) gab die Prinzessin Alma, Nicolos Tochter, die er sein innerstes „Wesen“ nennt. Wohl sprach sie ihre Rolle mit Anstand, aber das Sylphenhafte, die poetische Grazie blieb sie schuldig. Um diese beiden Hauptfiguren kreist das ironische Spiel. Da ist Hans Rüdgers als biederer Schlächtermeister und gar nicht übler Bürgerkönig,
da ist Kurt Sowinetz als komischer Damenschneidermeister. Und da sind die Schneidergesellen und die Richter, die Theaterbesitzer und die Bürger von Perugia — ein eifrig spielendes Ensemble. Doch die surrealistische Stimmung, die enge Verbindung von Höchstpersönlichem und maskenhaft Allgemeinem stellte sich nicht immer ein. Der lebhafte Beifall schien vor allem den Schauspielern zu gelten.
*
Von der Dynamik der dramatischen Sprache her ist der „Denkspieler“ Georg Kaiser gar nicht so weit entfernt von Wedekind. Auch bei Kaiser gibt es neben „schwarzen“ manchmal „rosa“ Stücke. Seine 1923/24 entstandene Komödie „Kolporlage — Geschrieben zur Förderung der Kinderfürsorge und des zeitgenössischen Theater“ gehört auf besondere Weise dazu. Kaiser tat damit einen ironisch gemeinten Griff in das „nackte Leben“ hinein. Denn Kolportage bedeutet: Leben im Dreigroschenstil, eine Kreuzung von Schundroman und Courths-Mahler-Geschichte, eine Mischung von Gemeinheit und rührseligem Edelmut, von Verlogenheit und Wahrheit, von albernem Zufall und unentrinnbarem Schicksal — alles das und noch viel mehr bedeutet Kolportage.
So ist das Leben, will Kaiser sagen, und führt uns den haarsträubenden Kolportageroman von der geschiedenen Gräfin Stjernenhö, geb. Bratt, vor. Um die Erbschaftsansprüche ihres Söhnchens,
das entführt werden soll, zu 'sichern, steckt sie ein Gossenbaby in den gräflichen Kinderwagen, woraus sich 20 Jahre später, am 21. Geburtstag des vermeintlichen Grafensohnes, ein zwerchfellerschütternder Familien-Gerichtstag entwickelt. Auch hier sollen Konventionen entlarvt, Überspanntheiten der Eibbiologie angeprangert werden. Daraus ist ein brillantes Spielwerk geworden, dessen dramaturgischer Mechanismus immer noch ergötzt, im Zeitalter der von sentimentaler Kolportage überwucherten Illustrierten erst recht.
Das Theater in der Josefstadt brachte unter der Regie von Hans Jaray, der auch den düpierten Kindsräuber Stjernenhö etwas farblos spielte, eine amüsante, das Parodistische eher dämpfende Aufführung zustande. Hervorragend war Hilde Krahl als herzhaft mütterliche, charmant kluge Frau Bratt. Neben ihr bestanden am besten noch Elisabeth Markus als imposant grollende Erbgräfin, Matthias Fuchs als erfrischend unbekümmerter und sympathischer Naturbursche aus Kansas und Harald Oslender als Musterexemplar gräflicher Erziehung. Während der sonst vortreffliche Theo hingen als Baron zwar eine urkomische Figur mimte, des Paro-distischen aber doch ein wenig zuviel tat. Auch Gretl Schörg als zunächst schlichte und später in aufgedonnerter Pleureusen-robe erscheinende Mutter Appelblom konnte nicht ganz überzeugen. Eindeutiger Lacherfolg beim Publikum.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!