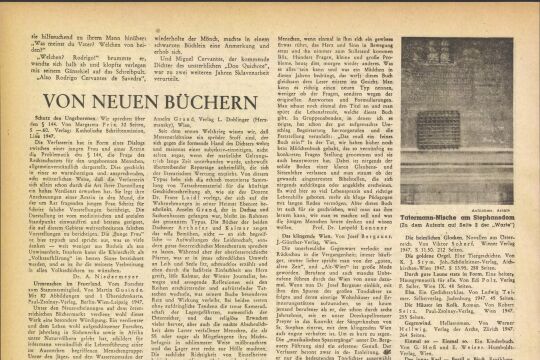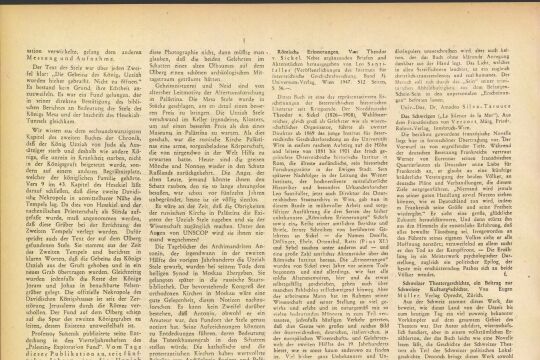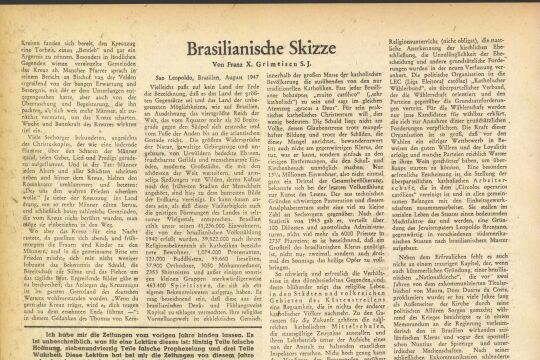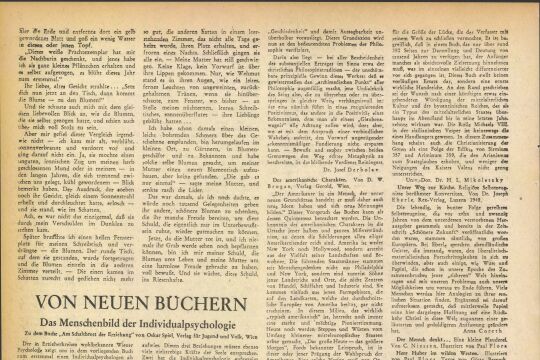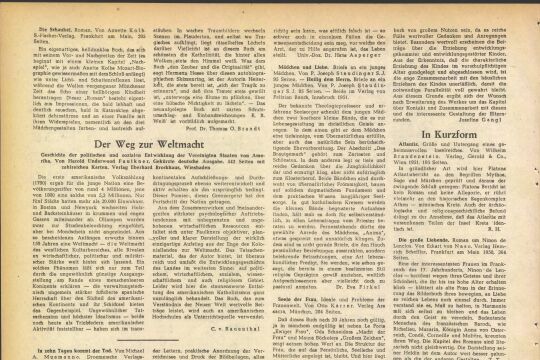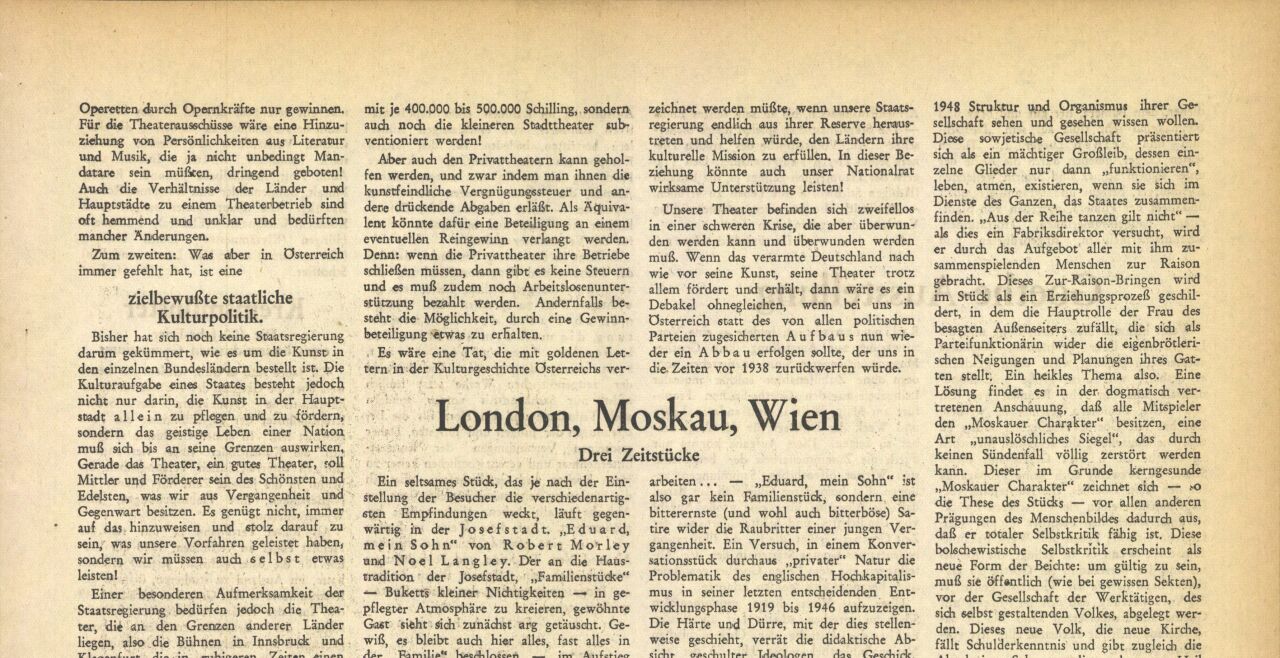
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
London, Moskau, Wien
Ein seltsames Stück, das je nach der Einstellung der Besucher die verschiedenartigsten Empfindungen weckt, läuft gegenwärtig in der J o s e f s t a d t. „Eduard, mein Sohn" von Robert Mo-rley und Noel Langley. Der an die Haustradition der Josefstadt, „Familienstücke“ — Buketts kleiner Nichtigkeiten — in gepflegter Atmosphäre zu kreieren, gewöhnte Gast sieht sich zunächst arg getäuscht. Gewiß, es bleibt auch hier alles, fast alles in der „Familie" beschlossen — im Aufstieg der Familie des Arnold Holt aus bescheidensten Anfängen zu einer wirtschaftlichen Führungsrolle im England Baldwins, Chamberlains und Churchills. In dieser Familie steht aber ein düsterer Schatten: Eduard, ihr einziger, verzärtelter Sprößling, um dessentwillen sein Vater, rücksichtslos boxend nach allen Seiten, einen Aufsprung auf der Gesellschaftsleiter erkämpft, der ans Märchenhafte anmutet (das triste Märchen des europäischen Spätkapitalismus). Eduard aber ist ein Schatten — er betritt niemals leibhaftig die Bühne. Mit Recht, denn es ist sehr die Frage, ob dieser „Eduard“ überhaupt etwas anderes ist als ein fleischlich gewordenes Symbol für den brutalen, hemmungslosen Egoismus seines Vaters, der bei all seinen Winkelzügen, Betrügereien und pedantisch-peinlichen Affären erklärt, nur um Eduards Heil willen so zu arbeiten… — „Eduard, mein Sohn“ ist also gar kein Familienstück, sondern eine bitterernste (und wohl auch bitterböse) Satire wider die Raubritter einer jungen Vergangenheit. Ein Versuch, in einem Konversationsstück durchaus „privater" Natur die Problematik des englischen Hochkapitalismus in seiner letzten entscheidenden Entwicklungsphase 1919 bis 1946 aufzuzeigen. Die Härte und Dürre, mit der dies stellenweise geschieht, verrät die didaktische Absicht geschulter Ideologen, das Geschick, diese Selbstentlarvung einer dekadenten Gesellschaft — in der Gestalt Arnold Holts — immerhin glaubhaft darzustellen, verrät mehr: die große selbstkritische Disziplin, Zucht und Begabung eines Volkes, das, neben dem Autor von „Peter, der Pflüger", Swift, Thackeray und Dickens (auch Shakespeare wäre einmal in diesem Zusammenhang neu zu untersuchen) der Welt ein großartiges Lehrschauspiel geschenkt hat: die englische Demokratie.
Die deutschsprachige Uraufführung des „M oskauer Charakter" von A n a- tolij Soffronow, besorgt, wie es ihres Amtes ist, die Scala. Dieses meisterhaft gespielte Stück, in dem man neben Parytas Regie den stark vibrierenden Willen und Pulsschlag eines echten Ensembles spürt, nennt sich eine „Gesellschaftskomödie“. Es ist nun hochinteressant, wie die Russen von
1948 Struktur und Organismus ihrer Gesellschaft sehen und gesehen wissen wollen. Diese sowjetische Gesellschaft präsentiert sich als ein mächtiger Großleib, dessen einzelne Glieder nur dann „funktionieren“, leben, atmen, existieren, wenn sie sich im Dienste des Ganzen, das Staates zusammenfinden. „Aus der Reihe tanzen gilt nicht“ — als dies ein Fabriksdirektor versucht, wird er durch das Aufgebot aller mit ihm zusammenspielenden Menschen zur Raison gebracht. Dieses Zur-Raison-Bringen wird im Stück als ein Erziehungsprozeß geschildert, in dem die Hauptrolle der Frau des besagten Außenseiters zufällt, die sich als Parteifunktionärin wider die eigenbrötlerischen Neigungen und Planungen ihres Gatten stellt. Ein heikles Thema also. Eine Lösung findet es in der dogmatisch vertretenen Anschauung, daß alle Mitspieler den „Moskauer Charakter“ besitzen, eine Art „unauslöschliches Siegel", das durch keinen Sündenfall völlig zerstört werden kann. Dieser im Grunde kerngesunde „Moskauer Charakter“ zeichnet sich — .-o die These des Stücks — vor allen anderen Prägungen des Menschenbildes dadurch aus, daß er totaler Selbstkritik fähig ist. Diese bolschewistische Selbstkritik erscheint als neue Form der Beichte: um gültig zu sein, muß sie öffentlich (wie bei gewissen Sekten), vor der Gesellschaft der Werktätigen, des sich selbst gestaltenden Volkes, abgelegt werden. Dieses neue Volk, die neue Kirche, fällt Schulderkenntnis und gibt zugleich die Absolution. Salus populi — das neue Heil der Welt; das autonome Volk, das sich selbst richtet, freispricht und erlöst. — Durch das offene Fenster des Zimmers im letzten Akt leuchtet, aus dunkler Nacht, das neue ewige Licht herein: der rote, aus Rubinen geformte Stern der Kremlkirche.
Die Stephansspieler bringen ein Wiener Volksstück um die Gestalt Dr. Karl L u e g e r s, „D e r P u m e r a" von R o- bert Maria Prosl. Dem Autor geht es offensichtlich nicht darum, die historische Erscheinung Luegers in ihrer geschichtlichen Größe und Problematik aufzuzeigen, sondern, zu frommer Erbauung, einen „Volks- Lueger" zu schaffen, einen legendennahen Lesebuchhelden, den „Freund seines Volkes", seiner Wiener, das heißt der kleinen Leute. Diese finden ihre symbolstarke Verkörperung in Luegers Leibgardist und Leib- diener, dem Pumera, der gut und brav und böhmakelnd sehr stolz auf sein „Deutschtum" und „seinen Lueger“ ist. Diesen seinen Lueger, gesehen durch die Brille der unter seinem Schutz und Schirm weilenden Kleinbürger, betreut und tyrannisiert, quält und liebt der Pumera, umgeben von Stadträten, Bandelkramerinnen, Hofrätinnen, Schuhmachermeistern, Abgeordneten und
ArmenKausinsassen, bis an sein seliges Ende.
— Die Stephansspieler spielen dieses biederselige Stück, Volksausgabe des „treuen Dieners seines Herrn“, ausgezeichnet. Den Trägern der Hauptrollen gelingt es, die .banalen flächigen Stichworte mit Leben zu erfüllen.
— Ein Stück also für einen gewissen Schlag Verehrer der „guten alten Zeit“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!