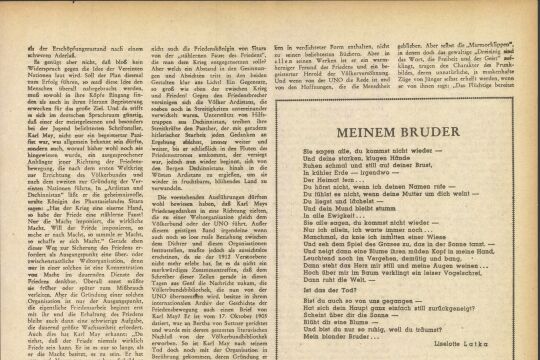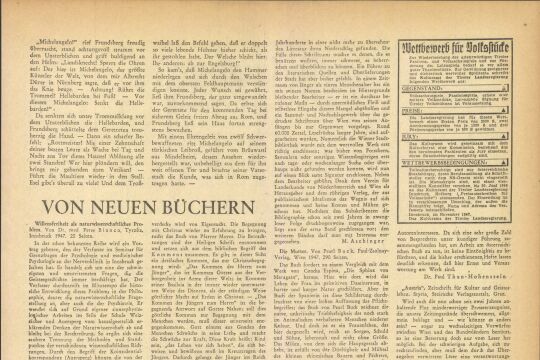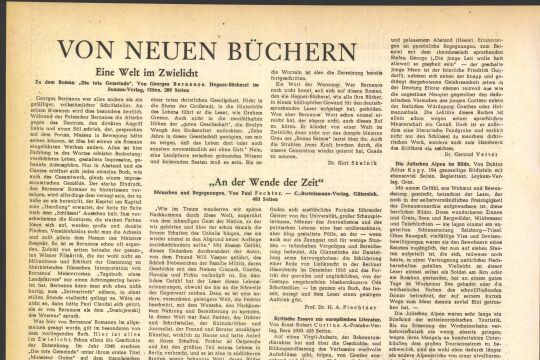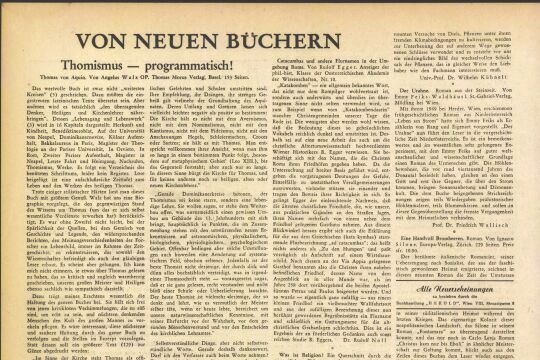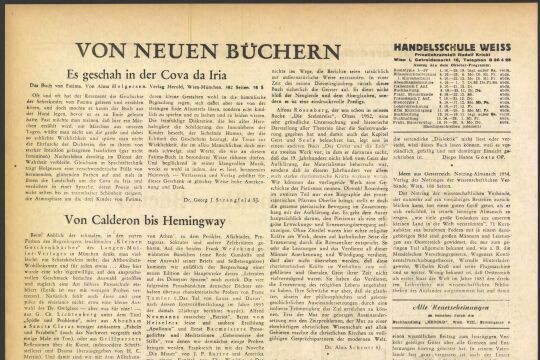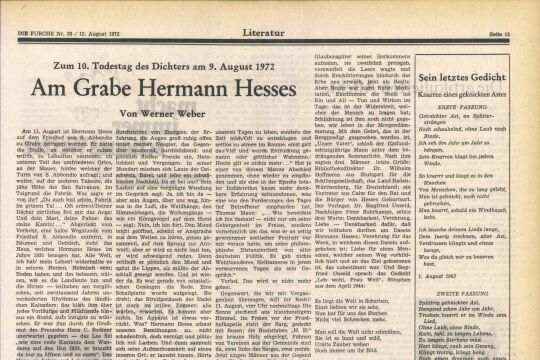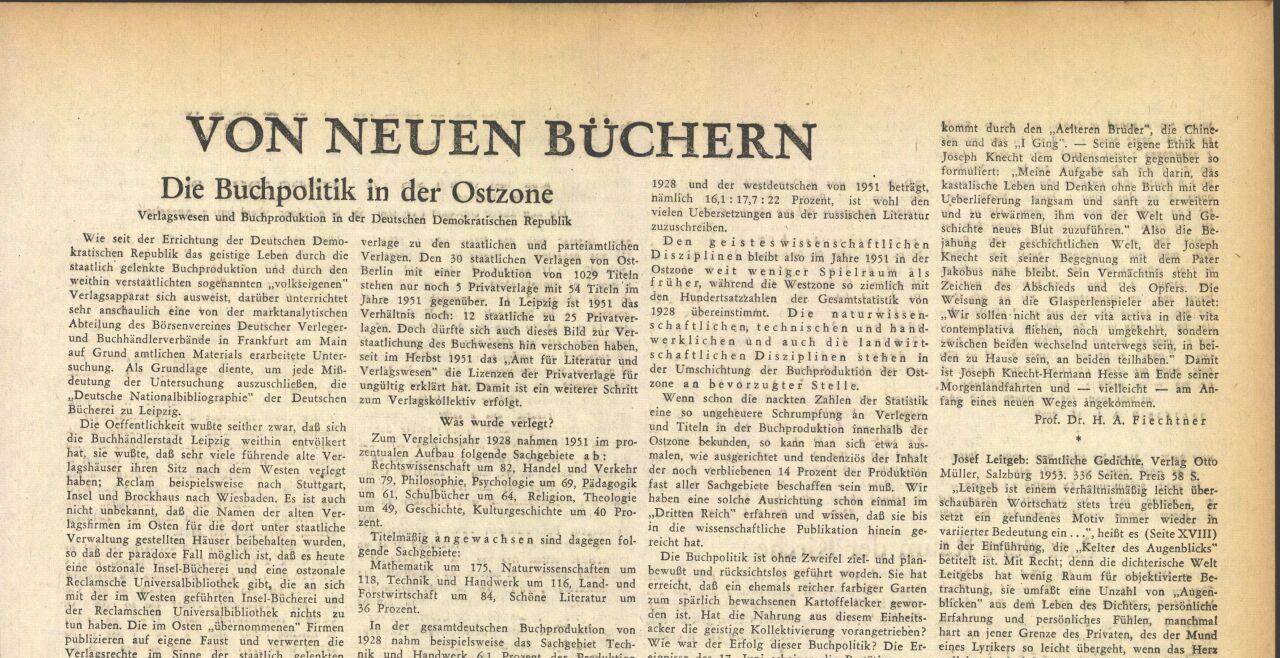
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Morgenlandfahrer und Glasperlenspieler
Hermann Hesse. Biographie 1952. Von Edmund Gnefkow, nebst einem Fragment aus der Zeit um 1937 — „Rückblick“ — von Hermann Hesse — Gerhard-Kirchhoff-Verlag, Freiburg i. Br. 143 Seiten
Ueber die Verbindung der Familie Hesse zum Fernen Osten, besonders zu Indien, berichtet nicht nur der Biograph Hugo Ball, sondern auch der Dichter in kleineren Selbstdarstellungen. — Er wandelte gewissermaßen auf den Spuren seiner Eltern und seines Großvaters, als er sich 1911 auf die große Reise nach Indien begab, wo die Mutter, Tochter eines Missionärs, zur Welt gekommen war, „früh ihres Vaters Gehilfin ward und Zum Teil auch Erbin seiher indischen Sprache und Weisheit“. Den Dichter Hermann Hesse führten andere Dränge und Interessen nach dem Osten. Der romantische Einheitsgedanke (die „mystische“ Identität von Ich und Welt bei Novalis, der Pantheismus Schellings mit dessen Lehre von der Dreieinigkeit Ich, Welt und Gott) wurzelt nachweislich in indischem Denken; er beherrscht auch Hermann Hesses Werke aus der mittleren und späteren Periode. Auf diesem Weg kam Hesse auch mit der Anthroposophie Rudolf Steiders in Berührung, deren Vorgebliches Wissen über Transzendenz und Welteinheit ihn anziehen; aber die Schriften der Theosophen scheinen ihm „unangenehm lehrhaft und tantenhaft klug“.
Nach der Darstellung Edmund Gnefkows begann Hesse seine östlichen Studien — mit Hilfe ungenügender Uebertragungen — spätestens 1907. Sein erster Fund ist die Bhagaväd-Ghita (aber erst 1914 schreibt er das Gedicht gleichen Titels). In der 1907 veröffentlichten „Legende vom indischen König“ ist das indische Einheitsdenken noch durch das deutsch-romantische Einheitsgefühl überdeckt. Von der Indienfahrt ist Hesse 1912 müde und enttäuscht zurückgekehrt. Auch die indischen Quellen, die er nun bewußt aufsucht und studiert (hinduistische, brahmanische und buddhistische Texte) befriedigen ihn nicht. „Ich suchte in dieser indischen Welt etwas, was dort nicht zu finden war, eine Art von Weisheit, deren Möglichkeit und deren Vorhandensein, ja Vorhandenseinmüssen, ich ahnte, die ich aber nirgends im Wort verwirklicht antraf.“ Die Psychoanalyse hatte ihm die polare Gespaltenheit und den Konflikt zwischen Bewußtem und Unbewußtem mit aller Schärfe gezeigt und ihn damit auf die Kernfrage seines Wesens hingewiesen. Aber diese ist. nicht lösbar durch die „spekulative Philosophie“ der Hindureligion, die die Welt als Schein beiseiteschiebt, sondern durch Leben und L“eiden, durch eine Synthese auf höherer Ebene. Dagegen werden die praktischen Uebungen der Konzentration, des Sichversenkens, wie sie die Jogi lehrten, für Hesse von großer Bedeutung. Im „Siddhartha“ sagt Hesse, was „des langen Suchens Ziel sei: Es war nichts als eine Bereitschaft der Seele, eine Fähigkeit, eine geheime Kunst, jeden Augenblick, mitten im Leben, den Gedanken der Einheit denken, die Einheit fühlen und einatmen können. Langsam blühte dies in ihm auf: Harmonie, Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt, Lächeln, Einheit“.
Aber dies war nicht mehr indisches Gedankengut, und Gnefkow weist nachdrücklich darauf hin, daß „Siddhartha“ nur äußerlich „indisch“ ist. In Wirklichkeit ist hier bereits der Einfluß der großen Chinesen, vor allem Lao-Tses, und des Taoismüs spürbar, die seinem Werk „jenen lebensvoll-kräftigen Einschlag der Güte, Heiterkeit und, ganz unbuddhistisch, des Einverstandenseins mit der Welt hinzugetan haben“. Hier ist auch der Ansatzpunkt jener Brücke, die vom sich selbst erlösenden Ich zum Wir führt. „Es ist die Erkenntnis des Lebendigen in uns, des geheimen
Zaubers, der gehei men Göttlichkeit, die jeder von uns in sich trägt. Es ist die Erkenntnis von der Möglichkeit, von diesem innersten Punkt aus alle Gegensatzpaare zu jeder Stunde aufzuheben.“
Hesse hat oft bezeugt, was er dem Ideal des chinesisch-taoistischen „Weisen und Guten“ verdankt. Er hat versucht, es der Idee des Weltfriedens dienstbar zu machen (Gesammelte Aufsätze „Krieg und Frieden“) und er hat ihm schließlich im „Glasperlenspiel“ ein Denkmal gesetzt, das nicht nur „ein Spiel mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur“ ist, sondern auch die „Annäherung an den über allen Vielheiten in sich einigen Geist, also an Gott, darstellen will“.
Der Untersuchung Gnefkows ist eine Studie von Gerhard Kirchhoff über das „Glasperlenspiel“ beigefügt, das an dieser Stelle bereits ausführlich besprochen wurde („Die Warte“ vom 20. Mai 1950). Ergänzend hierzu sei auf den Gedanken des Opfers hingewiesen, den Kirchhoff betont. Er
kommt durch den „Aelteren Bruder“, die Chinesen und das „I Ging“. — Seine eigene Ethik hat Joseph Knecht dem Ordensmeister gegenüber so formuliert: „Meine Aufgabe sah ich darin, das kastalische Leben und Denken ohne Bruch mit der Ueberlieferung langsam und sanft zu erweitern und zu erwärmen, ihm von der Welt und Geschichte neues Blut zuzuführen.“ Also die Bejahung der geschichtlichen Welt, der Joseph Knecht seit seiner Begegnung mit dem Pater Jakobus nahe bleibt. Sein Vermächtnis steht im Zeichen des Abschieds und des Opfers. Die Weisung an die Glasperlenspieler aber lautet: „Wir sollen nicht aus der vita activa in die vita contemplativa fliehen, noch umgekehrt, sondern zwischen beiden wechselnd unterwegs sein, in beiden zu Hause sein, an beiden teilhaben.“ Damit ist Joseph Knecht-Hermann Hesse am Ende seiner Morgenlandfahrten und — vielleicht — am Anfang eines neuen Weges angekommen.
Prof. Dr. H. A. Fiechtner *
Josef Leitgeb: Sämtliche Gedichte. Verlag Otto Müller, Salzburg 1953. 336 Seiten. Preis 58 S.
„Leitgeb ist einem verhältnismäßig leicht überschaubaren Wortschatz stets treu geblieben, er setzt ein gefundenes Motiv immer wieder in variierter Bedeutung ein ...“, heißt es (Seite XVIII) in der Einführung, die „Kelter des Augenblicks“ betitelt ist. Mit Recht; denn die dichterische Welt Leitgebs hat wenig Raum für objektivierte Betrachtung, sie umfaßt eine Unzahl von „Augenblicken“ aus dem Leben des Dichters, persönliche Erfahrung und persönliches Fühlen, manchmal hart an jener Grenze des Privaten, des der Mund eines Lyrikers so leicht übergeht, wenn das Herx voll ist. Auch daß er einem klar umgrenzten Wortschatz und den mit diesem verbundenen Motiven zeitlebens „treu“ geblieben ist, stimmt. Die auffälligen Wiederholungen erscheinen jedoch bei näherer Betrachtung als der oft unternommene Versuch, ein Motiv anders, besser als bisher, in Worte zu bannen. Leitgeb hat ein lyrisches Feld, das schon vor ihm nicht mehr neu war, redlich bestellt und mit bedeutender (wenn auch wenig origineller) Kraft bearbeitet. Und wenn der Herausgeber vernünftigerweise zugibt, man könne es dem lyrischen Nachwuchs „gewiß nicht verargen, wenn er den Namen Leitgeb nicht in die literarische Diskussion mit einbezieht“, so kann man auch dem nur zustimmen. Form und Inhalt dieser Gedichte sind durchweg traditionell, es gibt da weder thematische noch technische Experimente; der Wert des Werkes liegt in dem unbedingten Ernst, mit dem der Dichter das Vorgegebene übernimmt, ergriffen und feierlicfj gebraucht und also unversehrt (wenngleich unvermehrt) weitergibt. . Um so besser wären seine Verse für eine Breitenwirkung im guten Sinne des Wortes geeignet.
Dran Ich mich täglich entzücke, Bild des geliebten Gesichts, rettende Brücke über das Nichts!
In solchen Fügungen von sprunghafter Eindringlichkeit, die aus dem bedrängten Mehschsein über das immer mögliche Wunder des Alltags eine Brücke zu schlagen versuchen zum ewigen Menschentum, liegt wohl das Gewicht von Leitgebs lyrischer Leistung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!