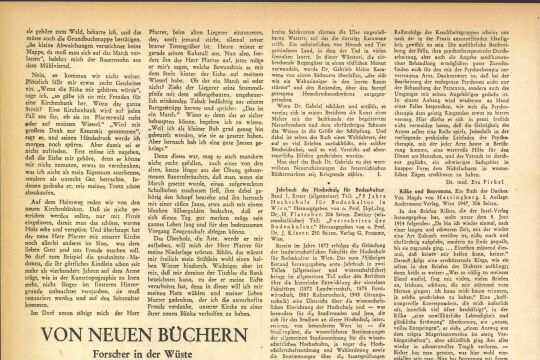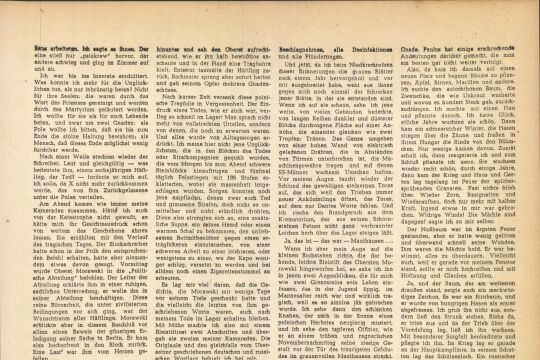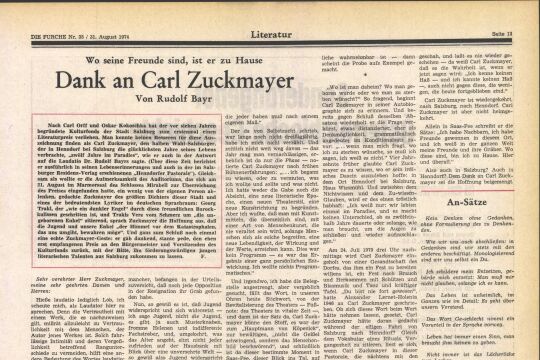Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
NICHT HASSEN - LIEBEN MÜSSEN
In seinem vor kurzem erschienen Erinnerungsbuch schreibt Zuckmayer: „Ich... erfuhr ... Glück, vielleicht das größte und gnadenvollste, das mir in meinem ganzen Leben beschieden war: Nicht hassen zu müssen.“
Was Zuckmayer zu dieser Aussage veranlaßte, war das überleben seiner geliebten Eltern während des Naziterrors und daß ein Mensch in der Maske des bösen Feindes, ein Ortsgruppenleiter, ihnen Gutes getan hatte, indem er die „nichtarische“ Abkunft der Mutter vertuschte, um sie vor einer möglichen Verfolgung oder Demütigung zu bewahren. Auch daß manche Freunde für die gute Sache freiwillig ihr Leben gewagt und verloren, ein Beispiel gesetzt hatten.
Ich glaube, daß das Wort vielleicht in Zuckmayers Aussage mir erlaubt, hinzufügen zu dürfen: lieben zu müssen.
Mag die Bewahrung vom Zwang des Hasses gewiß eine außerordentliche Gnade sein, so scheint mir doch der Zwang zur Liebe eine noch größere, eine wahrhaft göttliche Gnade, die jeglichen Haß meistern und — wie ich glaube — Schicksale, so der Eltern und Freunde, mitbestimmen kann.
Durch Zuckmayers ganzes Leben geht ungebrochen die Liebe zu allem Erschaffenen. Die zu Mensch und Tier ist aus seinem Leben und Werk so evident, daß ich nichts hinzuzufügen brauche, doch möchte ich diesmal als Forstmann sprechen von seiner Liebe zur vegetativen Natur. Bei langen gemeinsamen Fußwanderungen, die wir liebten und lieben, erst in Henndorf, dann in verschiedenen Orten der Schweiz, später umSalzburg herum und in Baden-Baden (es dürften viele hunderte Kilometer sein), betrachteten wir viel die Natur, besonders auch die Bäume, und ich war oft erstaunt, wieviel ein Nichtfachmann von Art, Wesen, Leben und Pflege der Bäume verstand. Nach den Jahren in Vermont, wo er als Farmer lebte, hatte er noch viele praktische Erfahrungen hinzugewonnen.
In Henndorf wanderten wir von der Wiesmühle durch Wälder und Wiesen über Hügel, öfter zum Wallersee, zu Zuckmayers Bootshütte, wo wir uns auf dem Steg ausruhten und mit einem Bad erfrischten. Der Steg war der geheimnisvolle Ort, wo „Zuck“ (so pflegten wir ihn im Freundeskreis zu nennen) beste Einfälle hatte. So sind ihm wesentliche Ideen zum „Hauptmann von Köpenick“ dort gekommen. Der Rückweg führte uns an einem Bächlein entlang, an dessen Lauf allerlei Bäume und Sträucher standen, die er wie gute Freunde alle kannte und mit besonderer Intensität betrachtete.
Einmal sagte mir der Ordinarius für Waldbau an der ETH in Zürich, Professor Leibundgut, einer meiner Lehrer, beim Besichtigen eines Waldbestandes auf einen herrlich gewachsenen jungen Baum weisend: „Diese Buche dort ist meine Geliebte.“ Dieser Ausspruch hätte auch von Zuckmayer sein können, ebenso vermag er zu sehen und zu empfinden.
Bei einem Spaziergang oberhalb von St. Jakob am Thum bei Salzburg führte ich „Zuck“ — wir wählten wechselseitig füreinander schöne Wege aus — zu einer alten großen Eberesche, die zur Herbstzeit mit roten Beeren derart behängen war, daß sie im Sonnenlicht wie ein Feuerball aufleuchtete, und erzählte ihm, daß mich dieser Baum zu einem Gedicht angeregt hätte. „Dieser Baum ist ein Gedicht!“ sagte er erschüttert von Erstaunen.
Dort in der Nähe gibt es einen zauberhaften Wasserfall ln einer Grotte mit einem großen Felsenbecken, in dem wir an heißen Sommertagen uns öfter kühlten. Wir nannten ihn den Nymphen-Fall, denn das mußte ihr Tummelplatz, verhangen von Zweigen, sein. Ein wahrlich märchenhafter Platz, ganz nach „Zucks“ Geschmack.
In Chardonne pilgerten wir vor und nach dem zweiten Weltkrieg durch die Rebhänge auf dem Mont Pelerin mit dem großartig weiten Blick über den Genfersee, bei guten Gesprächen über Gott und die Welt, zu denen dieser Pilgerberg besonders anregt. Weit wie die Landschaft ist Zuckmayers Geist: ob Rebstock oder Akazien, die man dort findet, ob ein Insekt oder ein Hufeisen, alles kann ihm zum Thema werden, das er beherrscht und bis ins Metaphysische weiterspinnen kann.
In Saas-Fee besuchte ich „Zuck“ und seine Frau schon vor dem Krieg, im Jahre 1938, und lernte in dieser grandiosen Bergwelt mit ihren Viertausendern auch die berühmten Lärchen kennen. In der Forstwissenschaft genießen sie Weltruf wegen ihres unwahrscheinlich hohen Alters von 600 und noch mehr Jahren und ihrer Qualität. So ist im forstwirtschaftlichen Institut in Zürich die Scheibe eines Lärchenstammes von Saas-Fee zu sehen, der an Dimension, Gesundheit in diesem Alter und Schönheit der Farbe alles übertrifft, was man sonst sehen kann. (Ich kenne die Lärchen, habe mich auf sie spezialisiert, da ich auf meinem früheren Besitz in Mähren besonders schöne Sudetenlärchen hatte, die man die „Hamburger“ nannte, weil sie früher für Maste von Segelschiffen dorthin exportiert wurden.) Nur die außerordentlichen Klima- und Bodenverhältnisse ermöglichen das: die meist trockene Luft, die intensivste Sonnenbestrahlung zuläßt und vor Fäulnis und Krankheit bewahrt, bei gleichzeitiger Feuchte des humusreichen Bodens. Das sind ideale Voraussetzungen für die in dieser Beziehung anspruchsvolle Lärche. Der Feldbau in Saas-Fee geht bis an die 2000-Meter- Grenze — eine Seltenheit in Europa. Einzigartig ist die Vegetation, die sich Zuckmayer zum Zusammenleben erwählte.
Die Liebe zur Vegetation scheint mir besonders geheimnisvoll: relativ unsinnlich, keusch, weil ihr Befriedigung fast nur durch das Auge, meist unbewußt durch Geschmacks- und Geruchsinn — so beim Genießen der Früchte —, kaum jedoch durch Gehör und Tastsinn wird. Der Mensch kann dem Menschen alle Sinne befriedigen, alle Liebe erwidern. Auch das Tier vermag da noch manches, so zum Beispiel der Hund, wenn er seine feuchte Schnauze in dankbarer Liebe an unsere Hand oder Wange schmiegt. Aber Dank, Gegenliebe für unsere Liebe und Pflege gibt die Vegetation nur auf Umwegen durch Gedeihen und Fruchten. Spontan gibt sie sich nur wenigen, so den Dichtem hin, die ihre Zeichen zu lesen und zu deuten vermögen. Ein Gedicht von Zuckmayer (das er mir während meiner schweren Augenkrankheit zum Trost schickte) sei hier als Beispiel angeführt:
H erbstliches Ahornblatt auf einem Waldbach treibend
Das war, als mir ein Weib im Wald begegnet,
Der ich den Sack mit welkem Laube trug,
Und als mich ihre Haselrute schlug,
Ahnt ich, im Schmerz: sie hatte mich gesegnet —
Und da ich noch den roten Striemen kühlte Auf meiner Hand, war all das nie geschehn —
Doch plötzlich könnt’ ich das Verborgne sehn,
Und blieb gebannt vor einem Zeichen stehn,
Das mir der klare Bach entgegenspülte.
Ein fünfgezacktes Blatt, herbstfarbengrell In Todeskränke zauberhaft verändert —
Blutrot geädert, purpurtief durchbändert,
Von schwarzem Rost gefleckt, monstranzenhell
Aus goldnem Grunde leuchtend. Langsam trieb Es in der Strömung, zittern fand Vor einem Stein es Halt, bis einer Welle Hieb (Gleichwie mit einer unsichtbaren Hand)
Es in den Strudel riß, und abwärts drehte,
Wo es in Schattenmurmelflut verschwand.
Ein kleiner Sog von seinem Stiel noch wehte Wie Stichlings Flitzen übern Kieselsand.
Ich aber lange, furchtergriffen, stand Und ohne Wissen wie im Stoßgebete —
Mir war, als ob ich an den Abgrund trete Und blicke schauernd über seinen Rand.
Wir sehen, daß dieses Gedicht mit dem alten Weib ganz märchenhaft beginnt — wie überhaupt Zuckmayer die Märchenwelt immer meisterhaft zu beschwören versteht — und in dieser Stimmung das Verborgene, das Zeichen: das Ahornblatt präzise in allen Einzelheiten, dabei prunkvoll und hintergründig dargestellt wird, bis es dann, wie von Geisterhand erfaßt, langsam entschwindet und uns vor dem Abgrund erschüttert zurückläßt. Dieses Erkennen (connaitre nennt’s der Franzose) des Blattes, dieses Zusammengeborenwerden gibt uns einen herrlichen Einblick in die Natur, ja über sie hinaus.
Als Zuckmayer nach dem Krieg in Deutschland als Verbindungsmann der Amerikaner in Kulturfragen aufopferungsvoll wirkte, eine so mühevolle Tätigkeit, daß sie ihn später fast an den Rand des Grabes brachte, trafen wir uns einmal, und unser Gespräch kam auf die Pflege des Waldes: wie die altmodische Niederdurchforstung (die Entnahme der Bäume aus den Beständen), die nur die dürren oder kranken und unterdrückten Bäume entfernte, sich zur Hochdurchforstung weiterentwickelt hatte, die auch die Bäume mit hohen Kronen fällt, um für die Entwicklung der besseren mehr Platz zu schaffen. Der Praktiker aus Vermont kannte das und interessierte sich für die neuesten Methoden. Ich erklärte, daß man die besten Stämme vor Sturm, Sonnenbrand und anderen Gefahren dadurch schützt, daß man sie mit auch weniger guten Bäumen umgeben, ummantelt beläßt, und formulierte: „Schonung des Minderguten zum Schutz des Besten.“ Da leuchteten seine Augen auf, und wir waren uns einig, daß das gleiche im ganzen Leben nötig sei. Denn das Leben des Menschen wie der Bäume ist eine Gemeinschaft; das Leben der Besten kann nicht isoliert bestehen, es braucht auch Hilfe und Schutz, und das Minder- gute hat auch sein Lebensrecht, seine Aufgabe, solange es für die Gemeinschaft keine Gefahr. So hat es Zuckmayer in seiner Stellung in diesen kritischen Jahren in selbstverständlichster und anspruchlosester Weise mit seinem Gebot, ja Zwang zur Liebe immer gehalten und damit allen Menschen deutscher Sprache einen unschätzbaren Dienst erwiesen: durch Ummantelung der Besten. Die „Kultur“ einer Sprache kennt keine Grenzen, wie wahre Kultur überhaupt keine Sprachgrenzen kennt.
Am Ende seines Erinnerungsbuches gibt Zuckmayer unter anderem eine meisterhafte Schilderung der Lärchen von Saas-Fee und zieht vor ihnen den Hut. Es ist sein Respekt vor der ganzen Schöpfung, seine Liebe zu ihr, die ihn dazu zwingt. Gibt es Schöneres. Höheres als der Zwang zur Liebe? Möge es ihm wie seinen Schicksalsgefährten, den Lärchen von Saas-Fee, mit Alter, Gesundheit und Leistung ergehen.
Diese Zeilen aber sollen nur ein kleiner Beitrag, ein Farb- tupfen zum Gemälde des großen Menschen und Dichters sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!