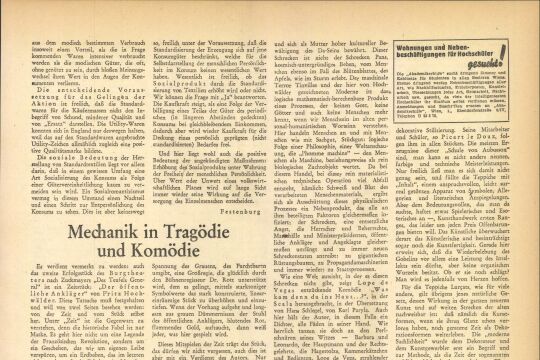Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schach der Phrase
In der Komödie „Dos Gartenfest“ des Prägers Vaclav Havel (Jahrgang 1936) ist Hugo Pludek, zunächst schüchterner Sprößling einer Familie des gesunden Mittelstandes, wie Vater Pludek bis zum Überdruß oft feststellt, ein leidenschaftlicher Schachspieler. Er spielt mit sich selbst, bald links, bald rechts, prädestinierter Typ des standpunktlosen Opportunisten des Ja und Nein, des Sowohl als Auch. Auf das Drängen der besorgten Eltern, wie er sich denn seine Zukunft vorstelle, weiß er keine Antwort. Als der vorsorglich eingeladene Protektionsmanager ausbleibt, besucht Hugo das vom Amt für Auflösung veranstaltete Gartenfest, welches vom Leiter des Eröffnungsdienstes eröffnet wird. Staunend vernimmt der noch ahnungslose Knabe auf dem eher traurigen als lustigen Fest nichts als Phrasen und leeres Geschwätz um sich. Hurtig paßt er sich an und übertrumpft bald die erfahrensten Beamten durch das geschickt nachgeahmte Funktionärskauderwelsch. Da der Eröffnungsdienist von dem Amt für Auflösung aufgelöst werden soll, wird eine Eröffnungsschulung für die Auflösungsbeamten und eine Auflösungsschulung für die Eröffnungsbeamten vorgeschlagen. Als sich das aber als unzureichend erweist, spinnt Hugo in seinem Gespräch mit dem Direktor den Gedanken weiter: „Man müßte noch eine Schulung anberaumen. Die für die Eröffnung geschulten Auflösungsbeamten würden die für die Auflösung geschulten Eröffner schulen, und die für die Auflösung geschulten Eröffner würden die für die Eröffnung geschulten Auflösungsbeamten schulen.“ Die Verbürokratisierung in dem gigantischen Verwaltungsapparat ist schließlich so vollkommen, daß der einzelne Funktionär bei dem hoffnungslos Aneinander-vorbei-Reden nicht mehr weiß, in wessen Auftrag er zu funktionieren hat. Die Atmosphäre der Angst, Unsicherheit und Ratlosigkeit nutzend, erklimmt Hugo die Spitze der bürokratischen Hierarchie. Am Ende des zur Phrase reduzierten Daseins hält er seinen Monolog vor den Eltern, die verwundert und ängstlich sich vor dem wichtig gewordenen Sohn zu fürchten beginnen. „... sind wir nicht alle ein bißchen das, was wir gestern waren und ein bißchen das, war wir heute sind, und ein bißchen sind wir auch das nicht. So daß keiner von uns vollkommen ist und gleichzeitig keiner unvollkommen,“
Hier erreicht die Entpersönlichung des gleichgeschalteten Individuums ihren Höhepunkt, wird die Satire zur erbarmungslosen Kritik an der Standpunktlosigkeit und dem Opportunismus inmitten eines menschenfeindlichen Mechanismus. Nicht mehr der Mensch bedient sich der Phrase, sondern die selbständig gewordene Phrase mißbraucht den Menschen.
Kafka, Ionesco, Schwejk sind die Paten dieser absurden Groteske, die aktive politische Gesellschaftskritik übt und mit vehementer Intelligenz für geistige Freiheit plädiert. Havels Gestalten — und das ist das Verblüffende an dem Stück — bewegen sich jedoch nicht wie stilisierte Marionetten in einer aus den Fugen geratenen und darum absurden Welt, sondern in durchaus vollblütiger realistischer Manier. Es sind tschechoslowakische Kleinbürger, die Pludeks, der Direktor Plzäk und all die andern — bis auf Hugo, den Karrieremacher. In ihm konzentriert sich der Prozeß der Entpersönlichung, er ist der seelenlose Zauberlehrling, der am Ende sein Gesicht verloren hat. So annähernd richtig spielt ihn Heinz Petters In der sehenswerten Aufführung im Volkstheater. Neben ihm agieren trefflich Harry Fuss und Herbert Probst als Direktoren, Oskar Wlllner und Marianne Gerzner als Ehepaar Pludek, Joseph Hendrichs und Traute Wassler als Untergebene — alle vielleicht um eine Spur zu gemütlich, so daß man bisweilen vor Komik den bitteren Ernst dahinter überhört. Regle führt gewandt Georg Lhotzky. Die bizarren Bühnenbilder von Ernst Bruzek wirken ein wenig zu kafkaesk. (Übrigens: Warum läßt man Hendrichs als Sekretär an der einzigen Stelle, da er in der Originalsprache redet, „Dosvidanie, Mama“ [Auf Wiedersehen, Manu] sagen, statt auf gut Tschechisch „Na shledanou, maminko“? Und warum hat man das im Original mehrmals vorkommende „Sind wir nicht alle so irgendwie von einer Mutter?“ in „Sind wir nicht alle so irgendwie von einer tschechischen Mutter?“ abgeändert und damit die Allgemeingültigkeit der Aussage eingeengt?) Aber diese Einwände wiegen wenig angesichts der Entdeckung, daß der modernen Komödie ein neuer, vielverheißender Dramatiker erstanden ist, den das jubelnde Publikum immer wieder an die Rampe rief. Bald dürfte auch sein kürzlich urauf-geführtes zweites Stück „Die Verständigung“ die Runde um die Welt machen.
Allzu sehr merkt man die Kluft zwischen der modernen dramatischen Form und der des 19. Jahrhunderts, gerät man aus dem Volkstheater Ins Theater in der Josefstadt oder umgekehrt. Hier spielt man das Schauspiel „Der öffentliche Ankläger“ von Fritz Hochwälder, im Mittelpunkt der „Blutsäufer“ Fouquier, der sich nach dem Sturz Robespierres in seinem eigenen Machtapparat verfängt. Doch die geschickte Spannung und dramatische Steigerung baut allzu sehr auf den Anteil des Schauspielers und seine Gestaltungskraft. Seinerzeit spielte Werner Kraus einen immer noch unvergessenen „öffentlichen Ankläger“. Erik Frey und seine Gegenspielerin Marion Degler kommen dagegen kaum über eine gewisse rhetorische Routine und ein veräußerlichtes Pathos hinaus. Fritz Muliar als Henker Samson verwechselt gar das Kabarett mit dem Theater. Einzig Franz Meßner in einer Episodenrolle ließ aufhorchen. Regie führte Paul Hoffmann. Das noble Publikum blieb kühl.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!