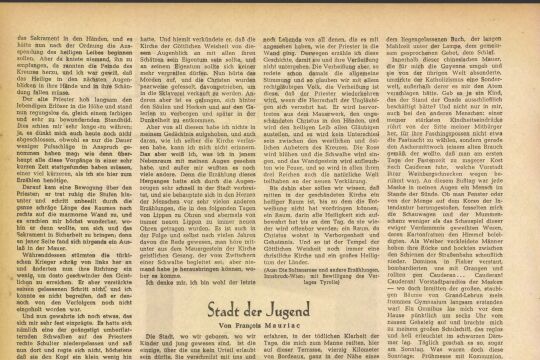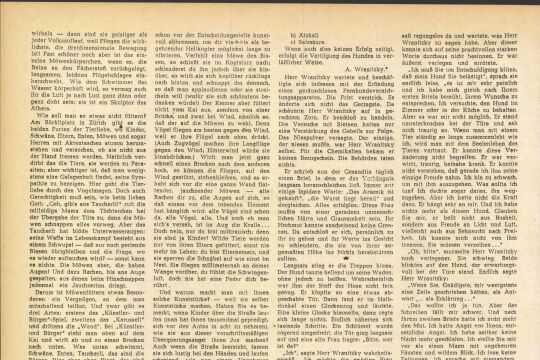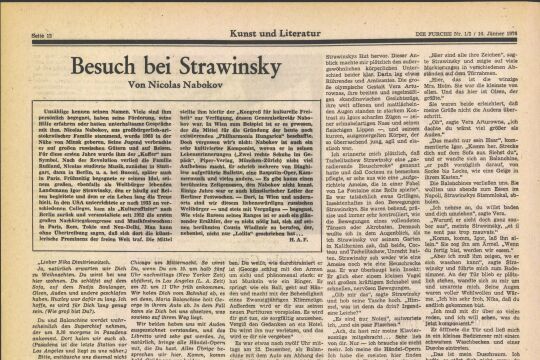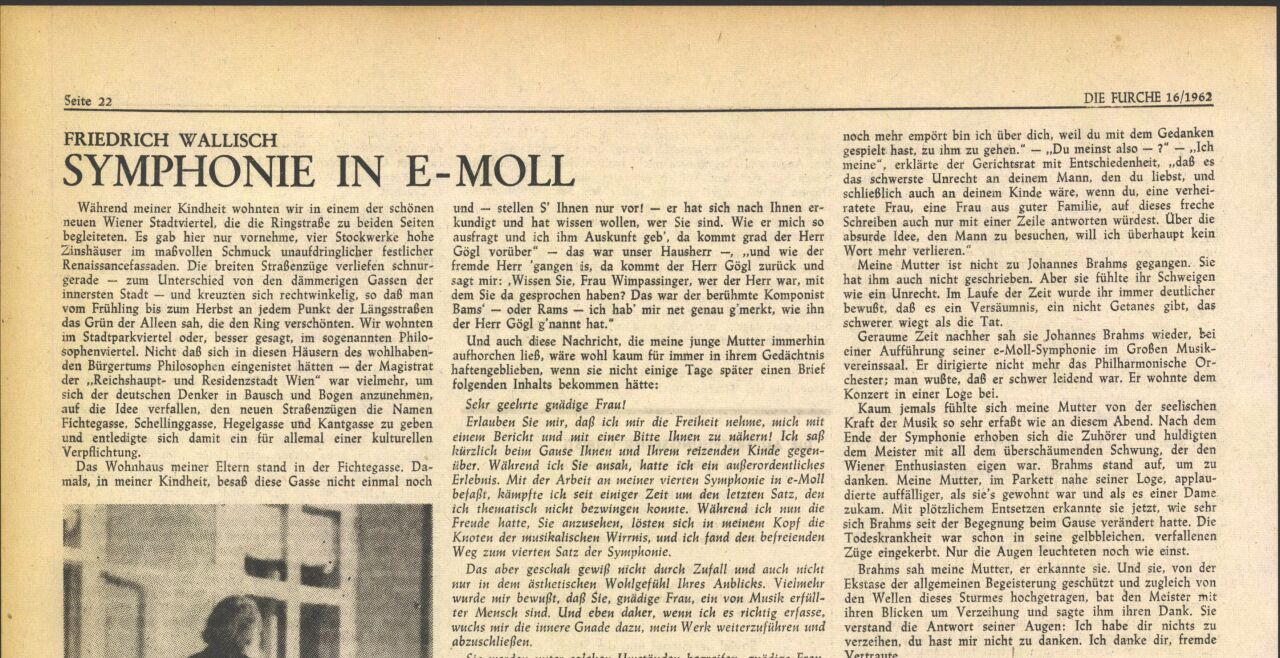
Während meiner Kindheit wohnten wir in einem der schönen neuen Wiener Stadtviertel, die die Ringstraße zu beiden Seiten begleiteten. Es gab hier nur vornehme, vier Stockwerke hohe Zinshäuser im maßvollen Schmuck unaufdringlicher festlicher Renaissancefassaden. Die breiten Straßenzüge verliefen schnurgerade — zum Unterschied von den dämmerigen Gassen der innersten Stadt — und kreuzten sich rechtwinkelig, so daß man vom Frühling bis zum Herbst an jedem Punkt der Längsstraßen das Grün der Alleen sah, die den Ring verschönten. Wir wohnten im Stadtparkviertel oder, besser gesagt, im sogenannten Philosophenviertel. Nicht daß sich in diesen Häusern des wohlhabenden Bürgertums Philosophen eingenistet hätten — der Magistrat der „Reichshaupt- und Residenzstadt Wien“ war vielmehr, um sich der deutschen Denker in Bausch und Bogen anzunehmen, auf die Idee verfallen, den neuen Straßenzügen die Namen Fichtegasse, Schellinggasse, Hegelgasse und Kantgasse zu geben und entledigte sich damit ein für allemal einer kulturellen Verpflichtung.
Das Wohnhaus meiner Eltern stand in der Fichtegasse. Damals, in meiner Kindheit, besaß diese Gasse nicht einmal noch ein Straßenpflaster. Zwischen den Gehsteigen gab es eine erdige Fahrbahn, ungefähr wie in einem Dorf. Die nächste Parallelgasse, die neue Johannesgasse, trug ihren unphilosophischen Namen als Fortsetzung der alten, in die Kärntner Straße mündenden Johannesgasse.
An der Ecke der Schellinggasse und der Johannesgasse, also in nächster Nähe unseres Hauses, befand sich das „Restaurant Gause“. Es war eine ausgezeichnete und vielgerühmte Gaststätte von gutbürgerlicher Art, angemessen den Bedürfnissen der Leute, die in dieser Gegend wohnten. Meine Eltern und ihre Freunde speisten oft „beim Gause“. Meine ältesten Erinnerungen an ein Gasthaus gehen auf den Gause zurück — Bierkrügel, Salzstangerl, befrackte Kellner und die gewissen, den Appetit freundlich reizenden Mischgerüche der Speisen und Gewürze.
Mein fleißiger Vater, der früher Militärarzt gewesen war, übte vom Spätfrühjahr bis zum beginnenden Herbst seine Praxis in Karlsbad aus, das damals in vollstem Sinne des Wortes ein Weltkurort war. Die Mutter blieb mit mir lange Wochen in Wien, ehe sie im Hochsommer zu ihrem Gatten reiste oder sich nach Baden in das Landhaus ihrer Eltern begab. So fügte es sich hin und wieder, daß sich die Mutter zu meiner Freude entschloß, mit mir kleinem Jungen eine Mahlzeit beim Gause zu nehmen. Es ist nun noch zu sagen, daß meine Mutter als ein schönes Erbe ihrer Eltern eine ungewöhnliche musikalische Begabung besaß. Sie war eine Lieblingsschülerin Anton Bruckners gewesen und hatte bei der Abschlußprüfung im Wiener Konservatorium die goldene Medaille errungen.
An einem der für mich hocherfreulichen Tage, da ich mit ihr zum Gause gehen und — Gipfel des Vergnügens! — mir dort wie ein Erwachsener die Speisen nach meiner Wahl bestellen durfte, saß uns gegenüber ein älterer Herr mit wallendem Vollbart und mächtiger Stirn. Mir erschien der Rauschebart kaum einer Beachtung wert, meine Mutter aber wußte, daß es der bekannte Dirigent und Komponist Johannes Brahms war. Meine Mutter, eine sehr junge, viel angehimmelte Schönheit, hatte sich längst an bewundernde Männerblicke gewöhnt. Daß der Herr am Tisch gegenüber sie aufmerksam betrachtete, wäre ihr als alltägliche Huldigung belanglos erschienen, hätte sie den Namen des Bärtigen mit dem wundervollen Künstlerkopf und seine Bedeutung nicht gekannt. Sie bemerkte, als wir den Speisesaal verließen, daß die blauen Augen des Mannes ihr nachblickten.
Dennoch wäre das flüchtige Zusammentreffen vielleicht bald aus ihrem Gedächtnis gelöscht worden; aber am nächsten Tag machte ihr Frau Wimpassinger eine merkwürdige Mitteilung. Frau Wimpassinger war die „Hausmeisterin“, auf hochdeutsch: die Portiersfrau, sie bekleidete also das in Wien höchst beachtliche Amt der Hüterin, Beobachterin und Auskunftsperson des Hauses, gewissermaßen das Amt eines verlängerten Armes des Wiener Polizeipräsidenten.
„Hörn S' zu, gnä Frau“, sagte sie wichtig, „gestern war a Herr bei mir, so a Kleiner mit viele Haar am Kopf und am Bart, i und — stellen S' Ihnen nur vor! — er hat sich nach Ihnen er-i kundigt und hat wissen wollen, wer Sie sind. Wie er mich so ! ausfragt und ich ihm Auskunft geh', da kommt grad der Herr Gögl vorüber“ — das war unser Hausherr —, „und wie der fremde Herr 'gangen is, da kommt der Herr Gögl zurück und sagt mir: .Wissen Sie, Frau Wimpassinger, wer der Herr war, mit i dem Sie da gesprochen haben? Das war der berühmte Komponist Barns' — oder Rams — ich hab' mir net genau g'merkt, wie ihn der Herr Gögl g'nannt hat.“
Und auch diese Nachricht, die meine junge Mutter immerhin aufhorchen ließ, wäre wohl kaum für immer in ihrem Gedächtnis haftengeblieben, wenn sie nicht einige Tage später einen Brief folgenden Inhalts bekommen hätte:
Sehr geehrte gnädige Frau!
Erlauben Sie mir, daß ich mir die Freiheit nehme, mich mit einem Bericht und mit einer Bitte Ihnen zu nähern! Ich saß kürzlich beim Gause Ihnen und Ihrem reizenden Kinde gegenüber. Während ich Sie ansah, hatte ich ein außerordentliches Erlebnis. Mit der Arbeit an meiner vierten Symphonie in e-Moll befaßt, kämpfte ich seit einiger Zeit um den letzten Satz, den ich thematisch nicht bezwingen konnte. Während ich nun die Freude hatte, Sie anzusehen, lösten sich in meinem Kopf die Knoten der musikalischen Wirrnis, und ich fand den befreienden Weg zum vierten Satz der Symphonie.
Das aber geschah gewiß nicht durch Zufall und auch nicht nur in dem ästhetischen Wohlgefühl Ihres Anblicks. Vielmehr wurde mir bewußt, daß Sie, gnädige Frau, ein von Musik erfüllter Mensch sind. Und eben daher, wenn ich es richtig erfasse, wuchs mir die innere Gnade dazu, mein Werk weiterzuführen und abzuschließen.
Sie werden unter solchen Umständen begreifen, gnädige Frau, daß es mein brennender Wunsch ist, meine Symphonie in e-Moll, die mit Ihrer Hilfe vollendet worden ist, Ihnen vorspielen zu dürfen. Ich bitte Sie daher: Machen Sie mir die Freude Ihres Besuches! Wenn ich Ihnen mein Werk zu Gehör bringe, wird es sich erst wahrhaftig harmonisch erfüllen.
Nehmen Sie keinen Anstand an der Bitte und an der Gewährung! Es ist ein alter Junggeselle, ein einsamer, harmloser alter Mann, der Sie bittet, ihm zuzuhören, wenn er Ihnen etwas vormusiziert.
In der Erwartung, daß Sie meiner höflichen Bitte freundlich entsprechen werden, empfehle ich mich Ihnen hochachtungsvoll als Ihr ergebener Johannes Brahms
Meine Mutter, jung, begeisterungsfähig, musikliebend, ja von ihrem Elternhaus her der Musik in allen Fasern ihres Herzens verbunden, hielt diesen Brief wie ein heiliges Feuer in ihren Händen. Ihr Gefühl rief ein tausendfaches Ja; allein die bürgerliche Zucht, unter der sie aufgewachsen war und lebte, richtete Schranken des Bedenkens auf.
In diesem Zwiespalt fand sie der gute Freund des Hauses, der Gerichtsrat.'Sie zeigte ihm den Brief, und um seine Einwände von vornherein abzuschwächen, erklärte.jie ihm, daß es ihr selbstverständlich erscheine, dieser bedeutsamen und weiß Gott nicht unziemlichen Einladung Folge zu leisten. Allein der Gerichtsrat war mit seinem Urteil bereits fertig gewesen, als er die letzte Zeile des Briefes gelesen hatte. „Du bist verrückt! Wie kannst du auf den Gedanken kommen, einen fremden Mann zu besuchen!“ — „Aber es ist doch nicht irgendwer“, wehrte sich meine Mutter. „Es ist Johannes Brahms.“ — „In zehn Jahren, meine Liebe, wird kein Hahn nach diesem Brahms krähen.“ — „Aber du hast doch in der .Neuen Freien Presse' Hanslicks begeisterte Kritiken über ihn gelesen!“
Der Gerichtsrat winkte ärgerlich ab. „Bleib mir nur mit Hanslick vom Halse! Bist du nicht eine Schülerin Anton Bruckners? Hast du vergessen, wie erbärmlich sich Hanslick über Bruckner geäußert hat? Und über Wagner? Bruckner und Wagner, an denen Hanslick kein gutes Haar gelassen hat, sind für alle Zeiten anerkannt. So gut ist das Urteil Hanslicks: die er verdammt hat, gehen in die Unsterblichkeit ein, und dieser Brahms, den er in den Himmel hebt, wird verschwinden, wie er gekommen ist.“
„Du sprichst gegen besseres Wissen“, sagte meine Mutter. „Du selbst hast dich über Brahms begeistert geäußert, wie wir sein letztes Konzert besucht haben. Was du heute sagst, ist gehässig.“ — „Weshalb sollte ich — ?“ — „Weil du diesen Brief gelesen hast —“, sie fügte leise hinzu: „ — und ihn mißverstanden hast.“ — „Ich bin über Brahms empört!“ rief er aus. „Und noch mehr empört bin ich über dich, weil du mit dem Gedanken gespielt hast, zu ihm zu gehen.“ — „Du meinst also — ?“ — „Ich meine“, erklärte der Gerichtsrat mit Entschiedenheit, „daß es das schwerste Unrecht an deinem Mann, den du liebst, und schließlich auch an deinem Kinde wäre, wenn du, eine verheiratete Frau, eine Frau aus guter Familie, auf dieses freche Schreiben auch nur mit einer Zeile antworten würdest. Über die absurde Idee, den Mann zu besuchen, will ich überhaupt kein Wort mehr verlieren.“
Meine Mutter ist nicht zu Johannes Brahms gegangen. Sie hat ihm auch nicht geschrieben. Aber sie fühlte ihr Schweigen wie ein Unrecht. Im Laufe der Zeit wurde ihr immer deutlicher bewußt, daß es ein Versäumnis, ein nicht Getanes gibt, das schwerer wiegt als die Tat.
Geraume Zeit nachher sah sie Johannes Brahms wieder, bei einer Aufführung seiner e-Moll-Symphonie im Großen Musikvereinssaal. Er dirigierte nicht mehr das Philharmonische Orchester; man wußte, daß er schwer leidend war. Er wohnte dem Konzert in einer Loge bei.
Kaum jemals fühlte sich meine Mutter von der seelischen Kraft der Musik so sehr erfaßt wie an diesem Abend. Nach dem Ende der Symphonie erhoben sich die Zuhörer und huldigten dem Meister mit all dem überschäumenden Schwung, der den Wiener Enthusiasten eigen war. Brahms stand auf, um zu danken. Meine Mutter, im Parkett nahe seiner Loge, applaudierte auffälliger, als sie's gewohnt war und als es einer Dame zukam. Mit plötzlichem Entsetzen erkannte sie jetzt, wie sehr sich Brahms seit der Begegnung beim Gause verändert hatte. Die Todeskrankheit war schon in seine gelbbleichen, verfallenen Züge eingekerbt. Nur die Augen leuchteten noch wie einst.
Brahms sah meine Mutter, er erkannte sie. Und sie, von der Ekstase der allgemeinen Begeisterung geschützt und zugleich von den Wellen dieses Sturmes hochgetragen, bat den Meister mit ihren Blicken um Verzeihung und sagte ihm ihren Dank. Sie verstand die Antwort seiner Augen: Ich habe dir nichts zu verzeihen, du hast mir nicht zu danken. Ich danke dir, fremde Vertraute.
Nicht lange nach diesem Abend bewegte sich mit allem dunklen Pomp, den Wien in seiner Trauer aufzubieten wußte, der Leichenzug des Johannes Brahms durch die Augustinerstraße. Aus dem Fenster des Philipphofes, in dem meine Großeltern wohnten, blickte ich, ein kleiner Junge, erstaunt und neugierig auf die schwarzen Pferde, den prunkvollen Leichenwagen, die Kränze und die vielen schwarzgekleideten Menschen. Diener der Leichenbestattung in schwarzer Livree, Frack, Kniehose und Federhut trugen Schilde, auf jedem Schild stand ein und derselbe Buchstabe. Ich hatte schon das ABC erlernt und konnte den Buchstaben lesen. Es war ein B.
Mein Großvater sagte mir, es bedeute „Brahms“. Aber ich wußte nicht, was Brahms bedeutete.