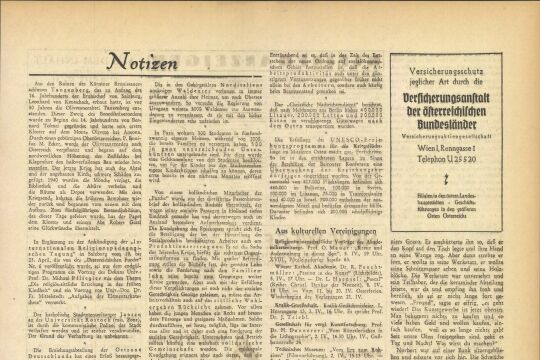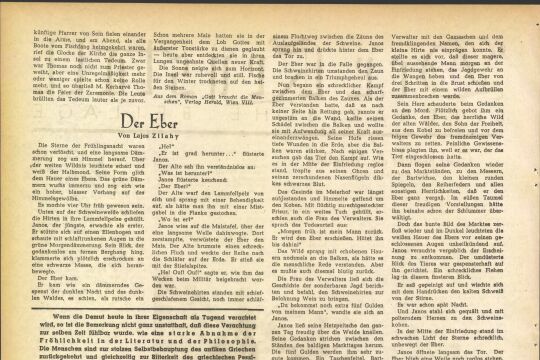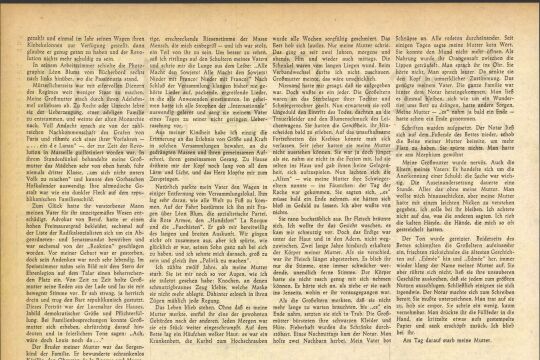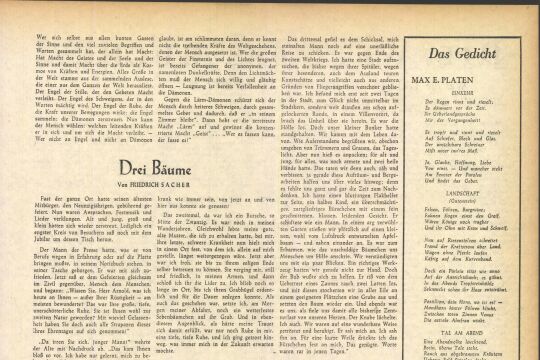Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
... und hat ihn nie mehr wiedergesehen!
Sandro nannten wir ihn damals. Später blieb Sandro weg, noch später auch Alessandro. Dann hieß er nur noch Moissi.
Er war schön! Er war der Abgott der Frauen. Er kam aus seiner Triestiner Heimat und war wohl erst ein halbes Jahr in Wien.
Im Deutschen Volkstheater gab es damals einen Elevenkurs, den frequentierten Sandro und ich. Der berühmte Strackosch, der beste Vortragsmeister seiner Zeit, der noch aus Laubes Schule kam, war dort Lehrmeister. Er war ein auffallend kleiner Mann mit einem riesigen Vollbart, trug einen imposanten Schlapphut und eine „Talentwindel“ (einen Havelock). Strackosch brachte uns Anfängern das Elementarste unseres Berufes, das Atmen und Sprechen, bei. Der Unterricht war kostenlos. Wir hatten nur die Verpflichtung, in den Klassikervorstellungen des Volkstheaters zu statieren.
Sandro war kein fleißiger Schüler. So oft Strackosch ihn vornahm, um seine Fortschritte zu überprüfen, war es ein karges Ergebnis. Wohl brillierte er mit seinen großen Talenten: ungewöhnliche Ausdruckskraft, fanatische Leidenschaft usw. — er schmiß uns alle um, wenn er die große Rede des Demetrius vor dem Reichstag in Krakau wiedergab —, aber es war seinem Vortrag anzumerken, daß er nichts gearbeitet hatte. So gut wie nichts, um vor allem seine Sprechmelodie zu verbessern. Er sprach eigentlich noch Italienisch. Er sang fast im Sprechen. Er war bequem, er war schon verwöhnt. Es'hatte sich auch bereits herumgesprochen, daß hier ein genialer Vagabund, ein Einmaliger, aufgetaucht war.
Er hatte keinesfalls die Allüren eines solchen. Im Gegenteil, er war äußerst bescheiden und er hatte einen umwerfenden Charme. Ich sehe noch heute seine herrlichen großen Augen, seinen gebräunten südlichen Teint, seine wundervollen Locken, und ich höre seine Stimme: seidig, geschmeidig. Sein Gang: federnd wie der eines Raubtieres. Ihm war nicht eine Sekunde zu trauen! Wir nannten ihn „den Sohn des Herakles“. Für uns war er Mark Anton, wie Gott ihn geschaffen.
Er trug übrigens auch einen Schlapphut. Eigentlich war's ein dreckiger „Ranftler“ — dazu einen geschenkten Cut und eine gestreifte Hose. Ich lief damals mit einem grünen Jäger-hütel herum, in einem himmelblauen Anzug. Auch der war geschenkt. ,
Unsere materiellen Verhältnisse waren natürlich nicht die besten. Wir ernährten uns von Gelegenheitsarbeiten. Ich, ein „redegewandter Herr“ — so nannte man damals die Akquisiteure —, ging von Trafik zu Trafik und bot din mürrischen Inhabern dieser trostlosen Vorstadtläden eine Kollektion Ansichtskarten an. Die aber kauften mir blutwenig ab, es reichte nicht einmal für die abgetretenen Schuhsohlen.
So versuchten wir's anders. Auch wir wurden Vortragsmeister. In Wirtshäusern trug Sandro den Demetrius, den Rustan und den Hamlet vor. Das Honorar dafür waren Saftgulasch oder Augsburger mit Erdäpfeln, die uns in der Schwemme kostenlos verabreicht wurden.
So geschehen, meist in den Abendstunden, beim Hauswirt in der Praterstraße, dem Stammlokal der Wiener Praterfiaker, oder bei der „Blauen Flaschen“ in der Lerchenfelder Straße. Ich glänzte mit dem „Streik der Schmiede“ oder mit Uhland: „Des Sängers Fluch.“
Wie oft wurden wir dort mit verbliebenen Resten aus der Küche beschenkt. Kalbsbraten oder Schweinernes, das wir in fettigem Zeitungspapier samt den Kartoffeln mit nach Hause nahmen. Ich kredenzte dann das Mahl meiner Mutter. Eine Gurke dazu und ein Monolog von Shakespeare ... ein Königreich!
Beim Leicht im Prater, dem Volksvariete, unter den dichten Kastanienbäumen, hatten v/ir unseren Sonntagsverdienst. Dort wurde immer ein blutrünstiges Ritterspiel gespielt. Sandro war stets der Gute, ich war der Schlechte. In jedem Akt töteten wir uns, spielten aber im nächsten wieder lebendig weiter. Dafür gab's einen Gulden!
Der Höhepunkt von Sandros Volkstheaterzeit war seine Bekanntschaft mit Helene Odilon, der ersten Salondame ihrer Zeit. Die war eine Kleopatra! Sie spielte sie aber niemals. Das war die Domäne der Gräfin Sullivan, der Wolter, am Burgtheater. Fanny Elßler studierte ihr stets den Mimus ein und Makart entwarf ihre Kostüme. Der Odilon konnte sie nicht das Wasser reichen, im Eros, in ihrer betäubenden Sinnlichkeit. Beide waren sie aus dem großen, heiligen Köln. Sie wären früher als Hexen verbrannt worden. Beide hatten den herrlichen rheinischen Frohsinn und waren sinnverwirrende Frauen.
Der nächste Abschnitt für Sandro war: Probesprechen im Burgtheater. Als es zu Ende war, hat ihn Adolf Ritter von Sonnenthal, der große Nathan, auf die Stirn geküßt. Es ist die Wahrheit. Ich hab' 'nen Eid im Himmel! Es ging wie ein Fanal über Wien!
Dann sah;ich Sandro erst nach. 30 Jahren wieder. In Salzburg, bei „Kabale und Liebe“. Reinhardt hatte sie zum siebenten oder achten Male herrlich inszeniert. Sandro spielte den Kammerdiener, ich den Präsidenten. Ich hatte nicht den Mut, ihn an die alten Tage zu erinnern. Längst verbrauchte Satze, wie: „Erinnern Sie sich doch ...“, „Wissen Sie nicht ...“ usw., mir gingen sie nicht über die Lippen.
Wozu also ein altmodisches Palaver? Erinnerungen austauschen? Ich schwieg. Seine Garderobetür stand, wohl zufällig, unausgesetzt offen. Oefter mußte ich daran vorbeigehen. Aber ich schwieg ... Die Vorstellung war zu Ende. Das festliche Haus applaudierte. Ich schwieg. Und hab' ihn nie mehr wiedergesehen!
PS.: Ich würde auch heute O. K., Oskar Kokoschka, nicht gegenübertreten und sagen: „Erinnern Sie sich nicht... wir waren doch ... !“
Damals war es übrigens noch nicht klar, ob er Otto oder Oskar heißt. Niemand wußte es. Weder der Zahlkellner im Cafe Museum, der ewig mürrische Fritz mit dem Wiedehopfschopf, noch die Speisenträger beim Hartmann in der Schwemme. Es wußte auch nicht die Wiesenthal, die nachmalig berühmte Tänzerin; auch Harta, der Maler, wußte es nicht. Auch nicht der Ysep aus dem Gailtal. Kein einziger der Stammgäste im Cafe Museum wußte es.
Vielleicht wissen es ganz genau noch Ernst Reinhold in London — den er damals als Trancespieler malte, mit den großen blauen Augen und der ausdrucksvollen linken Hand — oder der Tafler, der Einarmige, unsere damaligen Freunde? Jeder der beiden war damals drei Ringstraßenhäuser schwer. Was sie an Bargeld besaßen, verschenkten und verjuxten sie.
Der Maler Mop, der Max Oppenheimer, wußte es jedenfalls nicht. Er brauchte es auch nicht zu wissen. Der durfte es gar nicht. O. K. nannte ihn einen Farbensimulanten.
Zu gerne hätte ich aber gewußt, was mit dem „Amokläufer“ geschehen ist. Kokoschka malte ihn in der Wohnung des Schauspielers Musil, und ich sah gelegentlich die Entstehung des Bildes.
Kokoschka malte immer morgens. Musil lag nackt im Bett, trank seinen Kaffee, las die Morgenblätter, und Kokoschka malte. Er beendete das Bild nicht ganz. Den Grund weiß man nicht.
Ich weiß nur, daß der „Amokläufer“ dann lange Zeit in der Toilette stand. Dann verschwand er. Wo mag er hingerannt sein? ... Ich hab' ihn nie mehr wiedergesehen!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!