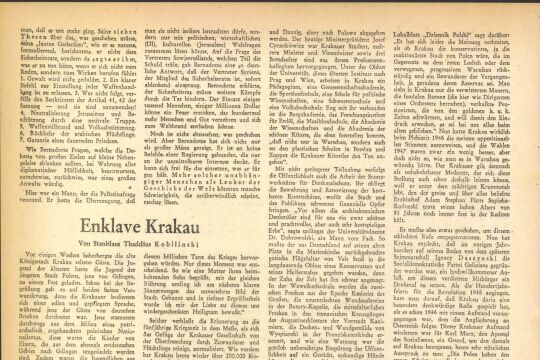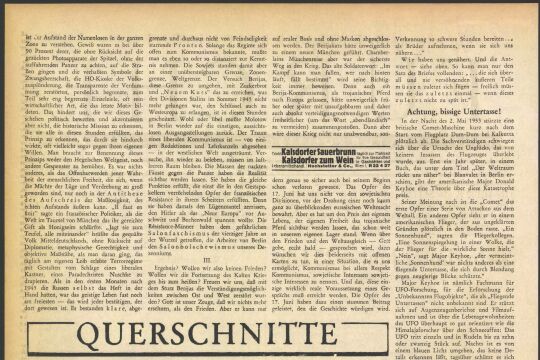Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Viktoria und ihr Deserteur
FASCHING. Roman. Von Gerhard Frltsch. Rowohlt-Verla;, Hamburg. 240 8. 8 146.50.
Wer hat noch nie den bösen Traum geträumt? Man befindet sich plötzlich wieder in einer ausweglosen Situation, wie tateächlich einmal vor Jahrzehnten. Man weiß dies genau. Man erinnert sich auch, daß es damals dann doch noch gut ausgegangen ist. Man ist aber nicht davon überzeugt, daß es noch einmal ein gutes Ende geben werde ...
Wer im Krieg, im KZ oder im Widerstand einiges mitgemacht hat, wird von Zeit zu Zeit von solchen Träumen heimgesucht. Gerhard Fritsch ist als ein literarischer Repräsentant der Kriegsgeneration bekannt. Den bösen Traum seiner Generation „verdichtet“ wiederzugeben: das ist der vielversprechende Ansatz für das vorliegende Buch, mit dem er sich nach bald einem Jahrzehnt wieder als Romancier meldet. Sein Inhalt: der 18jährige Felix Golub desertiert im Jänner 1945 von seiner in einem steirischen Städtchen in Garnison liegenden Ausbildungskompagnie eines Volks-grenadäerregiimentes — nicht zuletzt unter dem Eindruck einer Treibjagd auf waffenlose, entlaufene polnische Zwangsarbeiter, zu der die jungen Rekruten befohlen worden waren. Alles was anständig und unverbildet in dem jungen Menschen ist, bäumt sich auf. Wenn er schon kämpfen und sterben soll, dann lieber auf Seite der Opfer gegen ihre Mörder. Nahe sind die Partisanen. Der Weg zu ihnen endet nach wenigen hundert Metern in einer Grube uniter dem Fußboden des zwielichtigen Photographen Wazurak, zu dem Felix Vertrauen gefaßt und der Zivälkleäder versprochen hatte. Doch statt des Anzuges und dem Kampf gibt es MädcherMeider und ein Leben dm vergoldeten Häng Väktoriias: einer bis ins Mark wurmstichigen Erscheinung, mannstoU und frömmelnd, ehemaliger Tingeltengelstar, der sich einen alternden k. u. k. General erobert hatte und nach dessen Tod als „Baronin“ einen dämonischen Einfluß auf die Umgebung ausübt. In ihrem Haus und Bett wird Felix Golub, nun als Charlotte Weber firmiert, geistig und moralisch „fertiggemacht“. Als die Rote Armee naht, ermannt er sich im wahrsten Sinn des Wortes und es gelingt seiner Initiative durch Verhinderung des „Endkampfes“, das Städtchen vor der Zerstörung zu retten. Der „Dank“: Denunziation bei den Russen. 12 Jahre Sibirien.
Wie die Motte zum Licht, in dem sie umkommen wird, so kehrt Felix dann im das kleine Städtchen zurück. Dort ist alles beim alten. Die einst das große Wort geführt haben, sind nun wieder unter augenzwinkernden Zugeständnässen an die neue Zeit, obenauf. Und Viktoria sitzt, wie die Kreuzspinne im Netz, lauernd auf ihr Opfer. Dieses entgeht ihr nicht. In einem Fasching, der alle Dämonie, deren „unsere kleine Stadt“ fähig ist, entfesselt, wird der Außenseiter, der Deserteur vom Schicksal der Gemeänschaft und ihrer Gemeinheiten endgültig zur Strecke gebracht. Er landet än jenem Loch, aus dem einst die Flucht begann, beginnen sollte. Dort rollt die Handlung in Hunger- und Fäeber-phantasien ab.
Gelegenheit zu einer großen Zeit-und Gesellschaftskritik ist reichlich geboten. Doch Fritsch nützt sie, nach manchem Ansatz, leider nur zum Teil. Dabei sind jene Passagen, im denen er etwa die „Stimmung“ einer Garnison im Winter 1944/45, die Gedankenwelt eines jungen Völksgrenadiers beschwört, oder die Atmosphäre eines Kameradschafts-bundbaMes ein Vierteljahrhundert später wiedergibt, aber auch die scharfen Geißelbietoe auf eine leider bekannte, allzu große Duldsamkeit verschiedener Pfarrherrn gegen das Photographierunwesen während der Sakramentespendungen in den Kirchen der Wohlstandsgesellschaft und anderes mehr, nach Meinung des Rezensenten am stalteten, das heißt dem Talent des Autors am entsprechendsten.
Doch ach! Fritsch ist in der letzten Zeit immer stärker fasziniert durch die Sprachmagie und das formalistische Wortegedrechsel, wie es unter zeitgenössischen deutschen Autoren Mode geworden ist. Wer einfach erzählt, wer nichts anderes tut, als nur die Wirklichkeif zu „verdichten“, gilt dort als „out“. Auch darf es um Himmels willen nicht zu normal zugehen — Pathologie ist Trumpf! Darum hat Fritsch, der viele Jahre über diesem Manuskript gebrütet hat, seinem Roman letzten Endes eine Drehung gegeben: weg von der reinen engagierten Zeit-und Gesellschaftskritik, hin zu einem Hexensabbat, bei dem alle Provinizdämonen entfesselt werden. Nicht der Krieg und die Auflehnung des Menschen gegen das Unrecht und die Schändung seines Antlitzes, die Dumpfheit der Welt der „bien pensants“, dieser von der Schrift schon als übertünchte Gräber vorgestellten „Wohlanständigen“ steht im Mittelpunkt. Sie werden immer stärker nur zur Kulisse. Das scharfe Skalpell, das der Romancier gleich einem Chirurgen zu führen gedenkt, wird abgelenkt. Zurück bleiben „Viktoria und ihr Deserteur“ als ein sexuadpatfaologäscher Einzelfall, bei dem säch die vielem, die es angehen sollte, ruhig ihre Hände in Unschuld und Mandelseife waschen werden1: „Wir? Wir sind doch nicht gemeint!“ Eine Ausrede, die der Autor keinem hätte gestatten dürfen.
Der Rezensent gehört nacht unbedingt zu jenen die angesäcbts der Literatur unserer Zeät den verzweifeltem Ruf nach dem „Positiven“ ausstoßen. Allein er gesteht gern in dem vorliegenden Buch fehlt ihm unter all den Lemuiren zumdndestens ein Mensch. Felix, diese vollkommen entkernte Gestalt, äst es auch nicht. Und die Polin Fela Pomorska, die Felix liebt, ist nicht mehr als ein Schemen. Die Provinzmölle, die Fritsch mit all ihren Dämonen entfesselt, sei nicht geleugnet. Aber über die Hölle gibt es den Himmel und dazwischen auf jeden Fall die Erde. Auf ihr mag es Weäbsteufel, geile Böcke, Henker und Opportunisten in rauhen Mengen geben. Aber auch Menschen von Charakter und Redlichkeit, wie sie Fritsch vor zehn Jahren in seinem Roman „Moos auf den Steinen“ nicht verschmäht hat.
Hätte Fritsch vielleicht weniger Günther Grass gelesen, hätte er weniger streng „selektiert“ und dabei nicht vielversprechende Passagen die uns durch Vorabdrucke bekannt wurden, eliminiert, wer weiß: es hätte leicht der Roman einer Generation werden können, auf den wir schon so lange warten, den wir unter wenigen anderen auch von Fritsch erwarten.
P. S. Mit „Kathoiika“ tut sich Fritsch nicht immer leicht. Fürbitten für den Führer, das Groß-deutsche Reich und däe Wehrmacht waren in „jenen Jahren“ nach der Messe ebensowenig üblich (S. 54) wie der Ostermontag kirchlich „ein gebotener Feiertag“ (S. 112) war und ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!