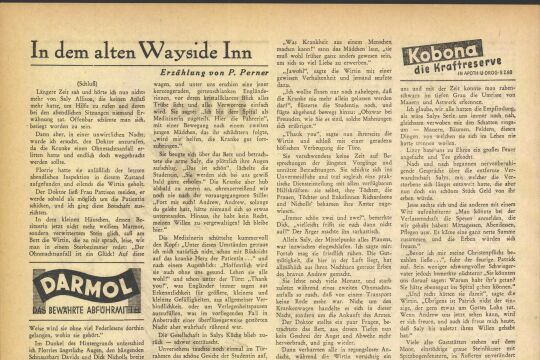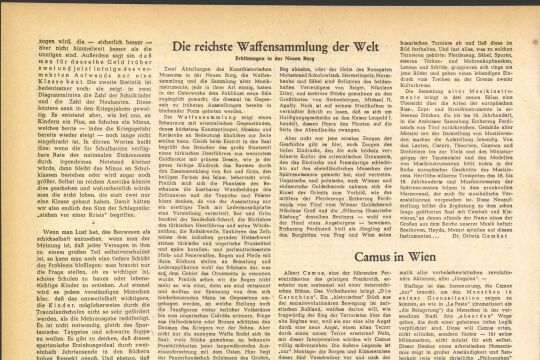Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Dorotheumstil
Die öffentliche Hand ist im Bauwesen langsam, kostspielig, unkünstlerisch. Sie wird täglich mächtiger, anspruchsvoller. Soll man lachen oder weinen? Soll man beides in einem tun: spotten?
Architektur bietet keinerlei Schwierigkeit, wenn man sie mit fremdem Geld, mit fremder Verantwortung und mit fremden Gedanken betreibt. Sie teilt sich 'je nach der gesellschaftlichen Ebene in den „Seppl- oder Jodelstil“ (in München so genannt), in den vornehmlich innenarchitektonischen „eigentlichen Dorotheumstil“ und im Amtsbereich in den „Hoheitsträger-“ oder „Plenipotential-stil“. Allen dreien, ob sie nun auf kraftvolles Brauchtum oder auf das Nachschmecken kunsthistorischer Entzückung oder schlicht und wahrhaft auf den Kreisleiterstil zurückgreifen, ist eines eigen: man kann sich mit ihnen nicht blamieren. Man hat Gleichgesinnte hinter sich, man braucht den Kopf nicht anzustrengen. Geistesökonomisch gesehen, handelt es sich bei allen dreien um den zweiten Nutzen, den das „von Herrschaften Abgelegte“ — der Bauer ist ein Herr — gewährt. Dieser wahre Stil hat keine Stacheln. Er ist in allen seinen Stufungen ein Streberstil par excellence. Er gefährdet nicht die Vorrückung, sein dritter Grad ist mandarinisch.
Die reinste Ausprägung des mittleren, des Dorotheumstils übte der Schriftsteller X, der, auf eine Trikotfabrik gestützt, in den zwanziger Jahren ein triumphales Stück geschrieben hatte. Er wohnte sommers in Venedig, hatte dort einen Stock des Palazzo Vendramin gemietet und mit Trödlerkram — Bildschwarten, gefälschten Möbeln, zurechtgebogenen Lustern und dergleichen — eingerichtet.
Er war, dies läßt sein Stück erraten, ein Möchtegern, ein Erotoman: Im letzten Raum des acht Meter hohen Piano nobile war sein kreisrundes Bett. Ein morscher Baldachin — er ließ durchfühlen: „vom Prunkschiff des Dogen“ — bekrönte es, und ein schwarzer Höllenpudel lag auf den seidenen Decken. X gab nichts zu essen. Er beleuchtete den Raum geisterhaft durdi — selbstverständlich antike — Appliquen, und die hübschen Frauen, die amerikanischen Filmleute und Seeoffiziere, die durchreisenden Snobs aller Sprachen, die er durch seine Freunde zwanglos bei Flo-riani zu sich bat, erschauerten vor den vermeintlichen Tintorettos, dem Pudel, dem Sterbesitz Richard Wagners und der Stelle, wo Cosima die Flut ihrer roten Haare über den Meister in den Sarg gelegt hatte. In summa war es grandioser, ja mirakuloser Dorotheumstil, mit einem Schuß Verruchtheit, wie es sich für Dichter des Expressiven gehört.
Auf geringerer, gut bürgerlicher Ebene übte ihn zu ungefähr gleicher Zeit Frau Gneraldirektor Y. Sie war der Schrecken, alsbald jedoch die Freude aller Möbeltrödler. Sie verband Kunstsinn mit Geschäftssinn und handelte tüchtig. Sie reiste viel und wurde von den Althändlern mit allen Tricks bis nach Ragusa heruntergereicht. Ein Freund schwur, Zeuge des denkwürdigen Feilschens um alttürkische Volkskunst gewesen zu sein, das an vielen Tagen mit unvergleichlichem Scharm und Frauenpsychologie und unzähligen Kupferkännchen Kaffee von dem gerissensten aller Antiquare geführt wurde. Der Kennerschaft der Dame gelang der Erwerb der Schätze zu maßvollem Preis zwecks Aufstellung derselben in der Villa über der Elbe. Einiges Anatolische stellte sich später allerdings als Warnsdorfer Wolldruck heraus, wie
er zirka 1840 in Massen für die Levante
erzeugt wurde.
Den Dorotheumstil übt man, wenn man — obwohl Kenner — kein Geld hat und eine gewisse Traditionsbeflissenheit für nützlich hält. Man kauft beim Sensal zweites Rokoko oder drittes Barock, läßt die Stühle mit Chintz oder Streifen überziehen, stellt den gebauchten Schrank vor die Rauhputzwand und sagt, es seien Erbstücke. Ein wenig Schmiedeeisen ist gut. Ebenso Düsternis — durch dickes Pergament erzeugt — wie im Vendramin. Ein moderner Kom-binations-Bar-Radio-Schrank gibt die interessante polare Spannung: antik — modern. Man legt ein gesticktes Meßgewand über den Preßstoffkasten. Alles dieses und viele andere Tricks beherrschte die oben erwähnte Dame in meisterhafter Weise. Sie pflegte zu sagen, daß sie ihre Architektur selber macht, die teuren Honorare erspart und ein „persönliches“ Milieu ihrem Gatten bereitet, welches mit dem Ismus der bockigen Eigenbrötlerfachleute — Gott sei Dank — nichts zu tun hat.
Ganz ähnlich leicht zu handhaben — nur nicht durch Versteigerung bewirkt und ohne die Süßigkeit eines weit unter dem Preis erworbenen Meisterwerks — gestaltet sich die Ausübung des Hoheitsträgerstils. Er erstrebt Großes: die Erstellung monumentaler Gebäude. Seine Krönung findet er durch die Vergoldung vorstehender Teile. Jeder Dilettant vergoldet gerne. Noch Baidur v. Schirach wäre tief beeindruckt von den aus der Hansen-Zeit stammenden, an der linken Seite des Parlaments befindlichen güldenen Kapitalen und Chimären. Der Plenipotentialstil steht auf der festen Grundlage der zuerst in München ausgeprobten motivischen Nomenklatur. Er ist noch heute bei uns herrschend. „Man nehme ein Ringstraßenhaus, schlage die Akanthusblätter und Eierstäbe ab, ziehe Rahmen um die Fenster, klebe Quadern an die Ecken, mache ein Steinprofil um den Eingang und hänge schmiedeeiserne Laternen auf. Das Produkt rührt man mit Pressempfängen und läßt es im Schräglicht photographieren.“ Handelt es sich um einen Neubau, so muß zuerst ein Wettbewerb, natürlich unter Verzicht auf die Autorenrechte, ausgeschrieben werden. Dadurch wird der „belanglose“ Grundriß einigermaßen ausgerichtet. Durch den bei jedem Mächtigen vorhandenen stillen Vorsteher des Entwurfsbüros werden die „Ideen koordiniert“. Das eigentlich Künstlerische — siehe oben — tut dann der Chef, wenn ihm an einem Nichtsprechtag die Muse zu Intimitäten Zeit läßt. Er kann ebensowenig einen Architekten ertragen, hat ihn ebensowenig notwendig wie weiland Frau Generaldirektor Y. (Nebenbei bemerkt: Baidur gängelte zwar, aber beließ den Architekten, ja — viel mehr —, er bezahlt e.ihn.)
Die Architekten, dieses merkwürdige Volk, welches der Meinung ist, daß man Künstler sein muß und diesen Ehrentitel nur mit schweren Wunden, Fehlschlägen, unter Einsatz der Leidenschaft und des persönlichen Rufes und keinesfalls durch Aneignung fremden Gedankenguts erwirbt, dieser Stand, der sich selbst zerfleischt, weil er Glaubenskriege um die Herausbringung des Ausdrucks der Zeit zu führen als sittliche Pflicht erachtet, ihm schwimmt täglich ein Teil seiner Felle davon.
Wie die Schauspieler, die mit Eitelkeit sich umgürten — aus Selbsterhaltungstrieb, weil durch geringsten Zweifel das Persönliche zerrinnt —, 6ind sie
glücklich, wenn ihre Maske, ihre Rolle, ihr Werk in der Bildzeitschrift erscheint. Ihre Eigenart wird gespiegelt, sie hallt zurück und bestärkt den Erreger. Aber das Stimulans hält nicht vor. Unterdessen hat ihnen Seppl und Jodel die
kleine, das Dorotheum die mittlere Aufgabe weggenommen. Bei der großen verkaufen sie die Idee für ein Trinkgeld, und ein Kollektiv verbal-hornt sie zur Unkenntlichkeit. Sie werden kirre, kriechen zu Kreuz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!