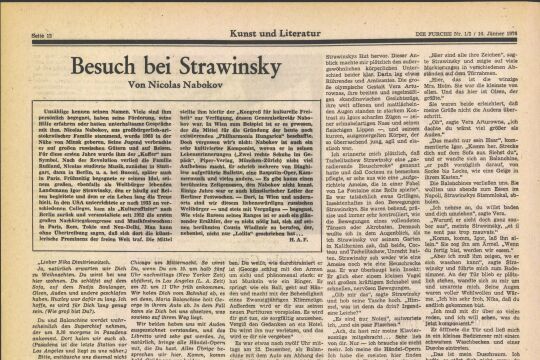Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der mysteriöse Herr X
Als letzte Festwochenpremiere fand im Theater an der Wien die Uraufführung der Opera buffa in drei Akten „Der mysteriöse Herr X“ von Alfred Uhl auf ein Libretto von Theo Lingen statt, das auf einen älteren Entwurf Lingens, der ja schon mehrere Stücke, meist zum Ėigengebrauch, geschrieben hat, zurückgeht. Ausführende waren Solisten, Chor und Orchester des Landestheaters Linz, wohin das Stück bald übersiedeln wird. — Den Komponisten Alfred Uhl müssen wir un
seren Lesern nicht vorstellen, da fast alle seine nach 1945 geschaffenen Werke an dieser Stelle besprochen wurden, zuletzt seine heitere Kantate „Wer einsam ist, der hat es gut“, die nach der Uraufführung 1961 auch in einem philharmonischen Abonnementkonzert im Februar dieses Jahres gegeben wurde. Begreiflich, daß Uhl, der Autor mehrerer erfolgreicher Orchesterwerke, nun auch einmal den Sprung auf die Bühne versuchen wollte, und man war gespannt darauf, wie er glücken würde.
Textautor und Komponist hatten sich vorgenommen, über das Sujet vor der Premiere nichts zu verlautbaren, und das ist ihnen, trotz zahlreicher Interviews in Presse und Rundfunk, auch gelungen, wo sie auf geradezu virtuose Art verstanden, um den Inhalt des Stückes herumzureden. Es geht darin um einen bewußt kitschigen und schablonenmäßig dargestellten Dreieckskonflikt zwischen Madame, Monsieur und Herrn X. Aber Madame ist zugleich auch Operndiva und Gattin des Herrn Z, während Herr X nicht nur ihr Liebhaber, sondern auch Heldentenor auf der Bühne ist. Die Exposition sieht so aus: In einem prunkvollen Salon im Super-Makart-Stil verabschiedet sich der Gatte vor einer Reise nach Paris von Frau Z, unmittelbar darnach erscheint der Liebhaber, Herr X, der jedoch vor dem unvermutet zurückkehrenden Herrn Z in den Schrank fliehen muß, wo ihn der eifersüchtige Gatte mit der Pistole in der Hand vergeblich sucht. Doch X ist verschwunden. Dazu die Anmerkung im Klavierauszug:
„Z schaut sich zu Frau Z um, sie hebt den Kopf und schaut ebenfalls verzweifelt. Dann blicken beide zum Kapellmeister. Das Orchester hat sich inzwischen in den Schlußteil des Finales gerettet und bemüht sich, auf diese Weise die sichtlich verfahrene Situation zu vertuschen. Zaghaft fällt der Hauptvorhang. Das Orchester spielt unentwegt weiter, kommt aber nach und nach mehr und mehr auseinander.“ Da erscheinen der Inspizient und ein Polizeikommissar. Nun dreht sich die Bühne, und man sieht hinter die Kulissen — und das Loch im Schrank. Der 2. Akt spielt auf der Unterbühne, und so geht es weiter, mit Theater auf dem Theater, solchen, die das Spiel durchschauen und anderen, die es ernst nehmen — wie der Kommissar, mit geladenen und ungeladenen Pistolen, einer Photographie als Corpus delicti, deren Widmung sich aber als gefälscht erweist. Und zum Schluß erscheint als Deus es machina auch der Komponist (in Puccini-Maske) und erklärt die alarmierenden Hilferufe: Es sei ein Streit gewesen zwischen ihm und dem Hauptdarsteller, dem seine Rolle und die ganze Oper nicht gefallen habe und der daher beschlossen hat, das Stück gründlich zu verderben
Das ganze Spiel ist zwar verwirrend, aber nicht immer sehr heiter, obwohl es an hübschen Details nicht fehlt, so, wenn zum Beispiel die Souffleuse verhört wird und zunächst in ihrer „Berufssprache“ nur flüstert, um dann plötzlich in kühne Koloraturen überzugehen. Sehr nett und musikalisch sorgfältig bedacht ist der ewig wartende Chor in weißen Ärzte-, Krankenpflegerund Schwesterntrachten mit seinem in Kurt-Weill-Stil komponierten
Refrain: „Was ist denn mit uns? Was sollen wir tun? Werden wir nicht mehr gebraucht? Wir möchten gern wissen, ob das Warten sich lohnt.“
Doch ist, trotz lobenswerter Kürze (knapp zwei Stunden Spielzeit), trotz authentischer Wiedergabe durch den Textautor als Regisseur und den Komponisten am Dirigentenpult und trotz einer sehr reizvollen Ausstattung (Heinz Köttel) die Unterhaltung nur mäßig. Man kann sich lebhaft vorsteilen, wie ausgezeichnet sich Librettist und Komponist bei der Ausarbeitung dieses Werkes verständigt und wie gut sie sich unterhalten haben. Auch mag es ein Stück für Sänger und Schauspieler sein, denn an effektvollen Partien und Gesangsnummem fehlt es nicht. Das
Ganze ist eines jener Produkte, bei denen auf eine fast mysteriöse Weise die Rechnung nicht aufgeht, wo der Effekt, nämlich die Wirkung auf den Zuschauer, weder der musikalischen Substanz noch dem Aufwand entspricht, kurz: wo das Ganze weniger ist als die Summe seiner Teile.
Das Premierenpublikum applaudierte einem mit großer Sorgfalt vorbereiteten Abend, einem heiteren Stück „als solchem“ und den zum Teil sehr erfreulichen Leistungen des Linzer Ensembles mit Peter Minnich als Gast in der Titelrolle. In den übrigen Partien: Die Damen Ferch, Kasper und Schubert sowie die Herren Malche, Lättgen (als Inspizient sehr gewandt, ja souverän), Siesz, Rosendorff, Gützlaff und Indra. Und man erfreute sich an einer gefälligen, quicklebendigen Musik im Stil etwa eines Wolf-Ferrari von 1966.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!