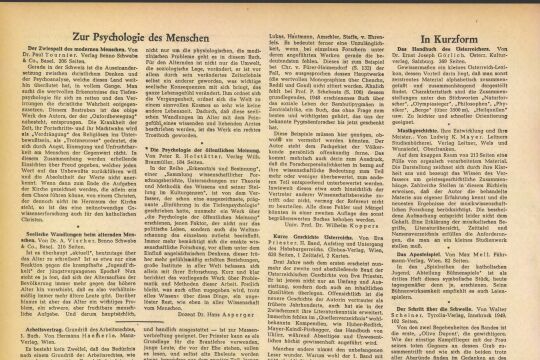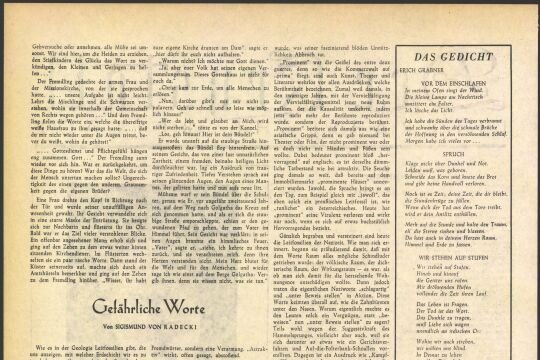Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„A anzig's Sdiädlweh"
Wenn man heute in einer versnobten Partygesellschaft sein Gegenüber mit „Hawara" anspricht, so ist man kein „Gscherter" mehr, sondern jemand, der literarisch „in" ist — jemand, der Wolfgang Teuschls „Jesus und seine Hawara" offensichtlich gelesen hat. Zwar gibt es och Leute, die sich darüber mokieren, daß das, was eine Marianne Mendt, ein Wolfgang Ambros oder ein Arik Brauer auf Schallplatten gesungen haben, kein Dialekt, sondern ordinärer Slang sei, doch der Trend von der gehobenen Umgangssprache weg ist nicht zu überhören.
Wenn man heute in einer versnobten Partygesellschaft sein Gegenüber mit „Hawara" anspricht, so ist man kein „Gscherter" mehr, sondern jemand, der literarisch „in" ist — jemand, der Wolfgang Teuschls „Jesus und seine Hawara" offensichtlich gelesen hat. Zwar gibt es och Leute, die sich darüber mokieren, daß das, was eine Marianne Mendt, ein Wolfgang Ambros oder ein Arik Brauer auf Schallplatten gesungen haben, kein Dialekt, sondern ordinärer Slang sei, doch der Trend von der gehobenen Umgangssprache weg ist nicht zu überhören.
In den „gehobenen Kreisen" ist es dso nicht mehr unbedingt notwen-11g, durch die Nase zu sprechen, seit ;ich die von H. C. Artmann „med ana ;chwoazzn Dintn"1 Mitte der fünfziger fahre eingeleitete Entwicklung zum Dialekt als Mittel der künstlerischen Artikulation nunmehr bereits so veit ausgebreitet hat, daß sich selbst ler Sproß einer renommierten Zuk-cerldynastie ihrer bedient und geneinsam mit Helmut Qualtinger auf blatte feststellt: „Wean, du bist a inziig's Schädlweh."
Das Interessante dabei ist die Tat-jache, daß ein Artmann, ein Bayer der Rühm (die für sich in Anspruch lehmen können, der inhaltlich „an-ipruchsvolleren" Seite ihres Metiers ^gerechnet zu werden), aber auch ;in Heller, Bauer oder Turrini denen der Dialekt des öfteren für ;ehr formale Aussagen dient), in je-len Kreisen, die diesen Dialekt als lltägliche Umgangssprache benutzen, keineswegs so populär sind wie n den Schichten mit einem sogenannten höheren Bildungsgrad.
Die Floskel, wonach alles schon ;inmal dagewesen sei, läßt sich in liesem Bereich scheinbar nicht anwenden. Jedenfalls wurde es uns doch so überliefert, daß etwa ein Grillparzer, dessen Stücke zu kennen heute selbst für den kulturell Uninteressierten eine Frage des „guten rons" ist, zu seinen Lebzeiten allein den „Gebildeten" vorbehalten blieb — ein Nestroy, ein Raimund, die „Dialektschreiber" vergangener Epochen also, konnten sich hingegen auf „ihr" Publikum aus der Vorstadt stützen. Genau jenes Publikum, das inzwischen zur Mittelklasse aufgerückt ist und heute die alten Klassiker auf das „Pflichtprogramm" gesetzt hat, während sich die jungen Intellektuellen (und solche, die zu diesen gerechnet werden wollen) bei Bauer, Turrini oder auch einem zu seiner Zeit kaum zur Kenntnis genommenen Ödön von Honrath vergnügen. Der wesentlich leichter zu überblickende und analysierende Bereich der sogenannten Unterhaltungsmusik scheint freilich noch besser dazu geeignet zu sein, gewisse Trends aufzuspüren, denn der Theater- und Literaturbetrieb spielt sich nach wie vor in einem eher kleinen Kreis ab, während sich via. Schall-plattenverkaufszahlen echte Massenbewegungen eruieren lassen. Und es ist noch gar nicht so lange her, daß man das, was heute „leiwand" ist, mit dem Wörtchen „happy" ausdrücken mußte, um im Showgeschäft das Ohr der Fans zu finden. Der
Dialekt war in dieser Branche gleichgestellt mit „Heurigenmusik" oder „Alpenjazz" — und diese Dinge wiederum bleiben Leuten vorbehalten, die von „gestern" waren, die sich kein modernes, kein internationales Appeal mehr zuzulegen vermochten.
Wolfgang Ambros hätte seinen „Höfa" damals kaum an Hitparadenspitzenplätze singen können und Marianne Mendt wäre vermutlich überhaupt nur via Wunschsendung der Sulmhof er-Mutter als „Gruß an dich" vorbehalten geblieben.
In der seichtesten und auch in der weniger seichten Muse hat man von einem Extrem zum anderen Extrem gefunden: von der krampfhaften Herbeizerrung „fremdländischer" Sprachfetzen zu heimischen Dialekten (vornehmlich dem „Weaner Beißerspruch"), die schon im nächsten Bundesland nur noch mit außergewöhnlicher Konzentration verstanden werden.
Die Urheber sind aber auch hier in letzter Konsequenz bei der „Wiener Gruppe" um Artmann, Rühm & Co. auszumachen. So machte etwa die von der Skiffle-, Folk- und Gospeliviusic Koiuiiieiiue ^ wiener; „wurried Men Skiffle Group" als eine der ersten den Dialekt populär, indem sie nach Konrad Bayer „Glaubst i bin bleed, daß i waß wia i haß" oder nach Friedrich Achleitner „I bin a Wunda" sang, bis sie selbst bemerkte, daß „da Mensch a Sau is". Ob diese „Sprachnaturalisierung", dieses „redn wia an's Maul gwochsn ist", bei der intellektuellen Jugend einerseits und anderseits aber auch das noch immer anzutreffende Unvermögen, sich zu artikulieren, das man bei Personen mit niedrigerem Bildungsniveau feststellt, wenn sich diese davor scheuen, gegenüber „Autoritätspersonen" den im normalen Umgang mit Menschen gewohnten Ton anzuschlagen, reiner Zufall ist?
Zufall sicher nicht — nur über die Ursachen mag man verschiedener Meinung sein. Mit Gewißheit scheint sich trotzdem eine Umkehr der Theorie von der „Identifikation von unten nach oben" (Wilfried Daim) ausmachen zu lassen. Es sieht so aus, als würde der Weg der sozialen Identifikation immer mehr von oben nach unten führen, seit die Bezugspersonen nicht mehr in der Regel aus der sozialen Oberschicht kommen, sondern aus der Unterschicht und dabei wiederum nicht diese anstreben, sondern ihren eigenen sozialen Status schaffen, der in keiner dieser beiden Schichten vollends angesiedelt werden kann.
H. C. Artmann könnte zur Untermauerung dieser These herangezogen werden. Er wuchs unter ärmlichen Verhältnissen in „Bradnsee" (Breitensee geschrieben) auf, hatte zweifellos nicht die besten Blldungs-chanceh (die als Grundvoraussetzung für sozialen Aufstieg angesehen werden müssen) und beherrscht heute — ein kleines Beispiel nur — acht Sprachen. Er beherrschte schon in jungen Jahren die sprachlichen Normen so perfekt, daß er es sich erlauben konnte, mit der Sprache zu experimentieren — sie so lange zu verfremden —, bis er wieder zu seiner „Muttersprache", dem Dialekt, zurückkehrte.
Durch seine Anerkennung als Literat konnte sich Artmann aber auch einen sozialen „Freiraum" erobern, der es wiederum mit sich bringt, daß sich sicher jeder Industrielle freuen wird, von „Adabei" in Zusammenhang mit dem „Bradn-seer" (bei dem solche Freude sicher keine Gegenliebe findet) genannt zu werden. So etwas wie ein neues Selbstbewußtsein jener von „unten", die genug Hürden überwunden haben, um bei denen von „oben" Anerkennung finden zu müssen, diese Anerkennung jedoch gar nicht zur Kenntnis nehmen, macht sich breit. Man verschmäht den sozialen Aufstieg und die Integration in höheren sozialen Schichten, was damit verbunden ist, daß man auch jene Konzessionen meidet, die überdurchschnittlich Begabte früherer Genera-
■ tionen auf dem Weg nach „oben" kennzeichneten — zum Beispiel das
1 Vergessen der eigentlichen „Muttersprache" und die Übernahme der : Sprachgewohnheiten der angestreb-' ten Klasse. Es scheint nun wenig-i stens von der Warte der Sprachge-
■ wohnheiten her so zu sein, daß die, l bei denen niemand mehr Anerkennung sucht, nun selbst jemanden
; suchen, um anerkannt zu werden. So betrachtet wäre die Dialekt-
■ welle mehr als nur eine Welle, son-i dern ein nicht unbedeutender politi-
■ scher Faktor. Doch wer betrachtet — l zumal in der betroffenen „modebe-
■ wußten" jungen Generation — eine • Modeerscheinunig schon von ihrer sozioiogiscnen öene, womit aucn ais gesichert angenommen werden kann, daß diese Modewelle über das Stadium der Mode für die breite Öffentlichkeit nicht hinauswächst? Oder mit anderen Worten: Die kulturelle Revolution findet nicht statt, wo das kulturelle Bewußtsein nicht vorhanden ist. Wir können also weiter ruhig schlafen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!