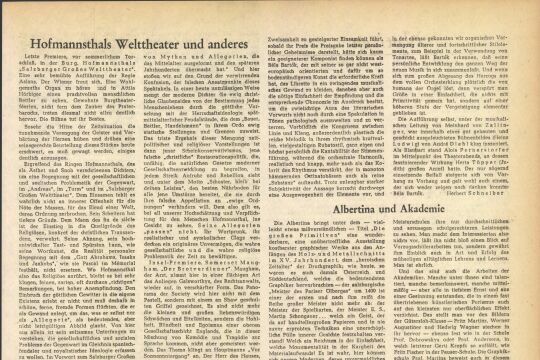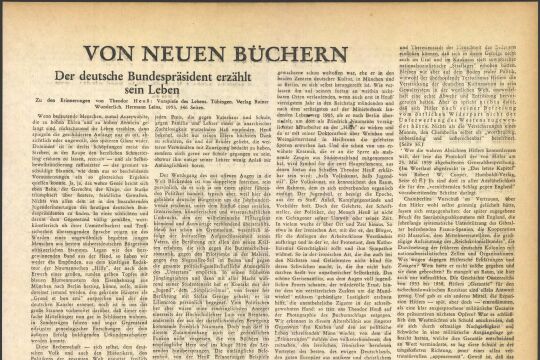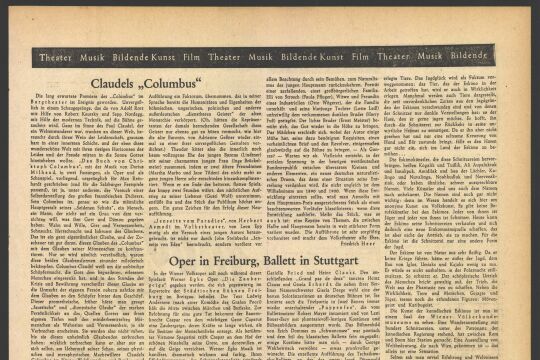Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
An der Größe der Bilder gescheitert
Ein Stück an der Zeitenwende, eine Tragödie der Zeitenwende: Von 1918 bis 1925 arbeitete Hugo von Hofmannsthal an der ersten Fassung seiner Tragödie „Der Turm“, 1927 entstand die zweite Fassung (ohne die shakespearsche Hexenbeschwörung der Toten nach Macbeth-Art), und ohne die Apotheose des Kinderkönigs). Eine Kultur, durch Korruption, Gewalt und Machtgier der Großen, durch reaktionäre Machtversteinerung ins Bestialische abgeglitten, bricht zusammen. Die alte Welt der geheiligten Majestät geht zugrunde, die Neuen, die um Gerechtigkeit ringen und diese Welt bekämpfen, scheitern in ihren Sümpfen. Doch auch sie werden nur Zwischenkönige sein. Das utopische „Reich der Kinder“ erst bringt die Vollendung. Doch ist es noch von dieser Welt?
Eine Apokalypse wollte Hofmannsthal schreiben. Ein Drama, maßlos befrachtet mit europäischem Geistesgut, ist daraus geworden. Ein Stück vom Sterbenmüssen. Endspiel. Ein Stück, das schon in der ersten Fassung merkbar Hofmannsthals Griff entglitten ist. Zuviel Symboltiefe, zuviel bei Shakespeare („Macbeth“), Calderön („Das Leben ein Traum“), der Welt des Barock Abgeschautes und Abgelauschtes, zuviel Traditionen und Gedanken werden da gebündelt, zuviel Mystik und Erlösungswille verpackt. Die Dramaturgie hat all das nicht mehr zu klären vermocht, dem Stoff fehlt die klare Linie, fehlen die scharfen Konturen, die dieses Welt- und Passionstheater in einem zum packenden Drama werden lassen.
Peter Janisch hat das Werk dankenswerter Weise für den prachtvollen Kolomanihof des Stiftes Melk ausgewählt. Wieder ein Versuch, das Lesedrama zu retten, das kaum zu retten ist. Denn man müßte schon die Kühnheit und Sicherheit eines Strehler besitzen, um den „Turm“ in seiner ganzen Tiefe auszuloten. Und selbst dann wäre es wohl nur mit durchwegs fabelhaften Schauspielern, mit genialen optischen Einfällen, einer märchenhaften Ausstattung möglich, mitzureißen. Wie gesagt, Janisch wagt kaum, auflösbare Sprachbilder szenisch umzusetzen. Aber es mißlingt. Bild für Bild spürt man mehr dieses Unbehagen, das szenisch Ungelöstes verbreitet. Das Zerbröseln von gewaltigen Metaphern, weltdeutenden Gleichnissen, kühner Prophetie. Und schon die Sprache bleibt unbewältigt. Was müßte sich Janisch alles einfallen lassen, um die ungeheuer feinfühlig gedachten Dialoge unter diesen akustischen Verhältnissen verstehbar zu machen.
Da fehlen denn unendlich viele Nuancen, fast alle Zwischenwerte, dieses langsame Reifenlassen von seelischen Eruptionen und tödlichem
Lasten untilgbarer Schuld (bei König Basilius); dieses Hineinwachsen in große Gesten, etwa beim Prinzen Sigismund, der sich immerhin wandeln muß: vom Burschen, der wie ein Tier im Gefängnis gehalten wird, zur königlichen Majestät, dem ein fast heiliges Sendungsbewußtsein die Kraft zu Siegen gibt; die Kinderkönigver-sion schließlich, die das utopische Reich aufschließt...
Janisch hat zwar einen kalten, harten, abergläubisch versklavten König Basilius zur Hand, Ernst Meister, der die Rolle sprachlich makellos gestaltet, der dieses männliche Gegenstück zu Hofmannsthals Klytämnestra beklemmend modelliert. Aber er könnte noch wachsen, wenn ihm in Peter Wolsdorff wirklich ein Sigismund entgegenträte, der die volle Entwicklung zum neuen König durchspielt. Da bleibt aber vieles angedeutet, vieles geht verloren. Auch die tief ins Fleisch des Königs sich fressende de-
mütigende Begegnung mit seinem ehemaligen Kanzler und Almosenier des Reiches, Pater Ignatius (Peter Gerhard), versickert in Larmoyanz. Der getreue Diener Anton, der als Anleihe aus dem barocken Wiener Volkstheater in Basilius' Traumland Polen, in den Turm geraten ist, wird von Richard Eybner überhaupt als lieber, raunzender Onkel gespielt, in dem von menschlichem Gewissen, von der praktischen Ubersetzung in tätige Nächstenliebe, nur noch eine Karikatur übriggeblieben ist.
Kein Wunder also, daß das Publikum der Eröffnungspremiere — trotz lauer Sommernacht und der herrlichen Atmosphäre des Hofs — eher flau reagierte, sparsam applaudierte. Dennoch: wer Hofmannsthals „Turm“ kennenlernen will, sollte wenigstens mit dieser fragmentarischen Verwirklichung Vorlieb nehmen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!