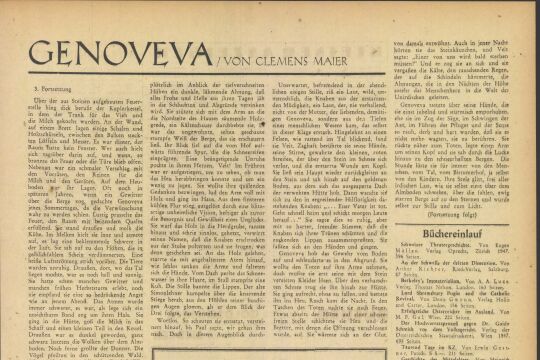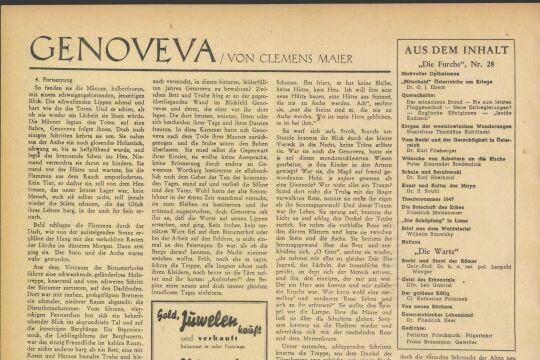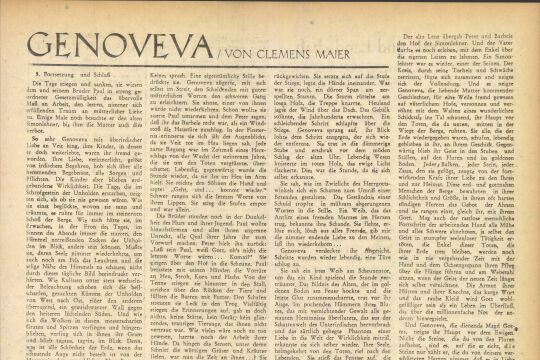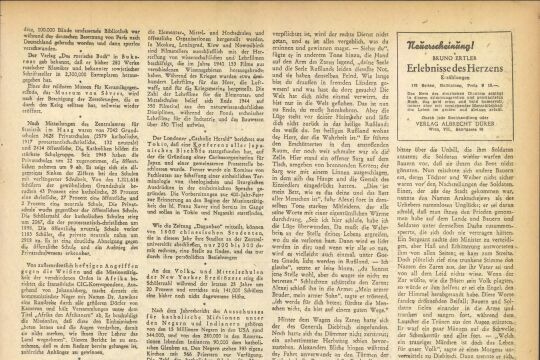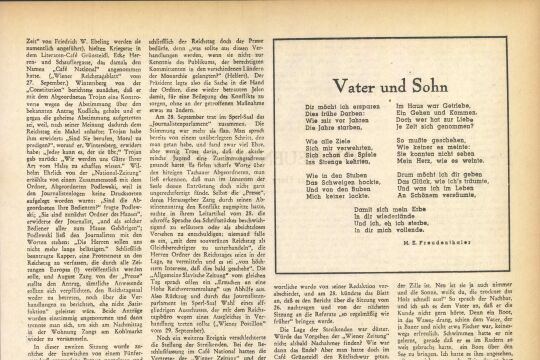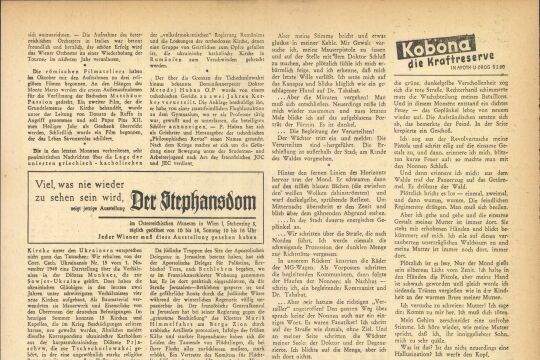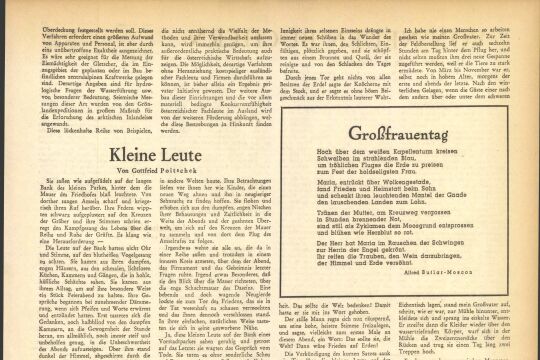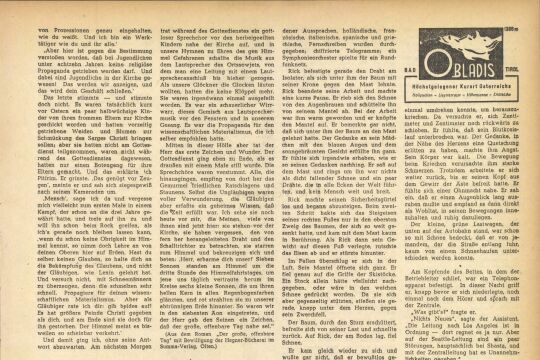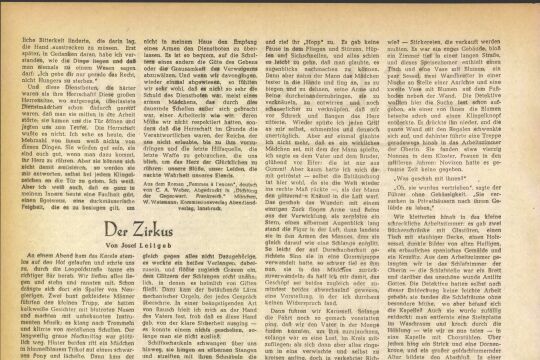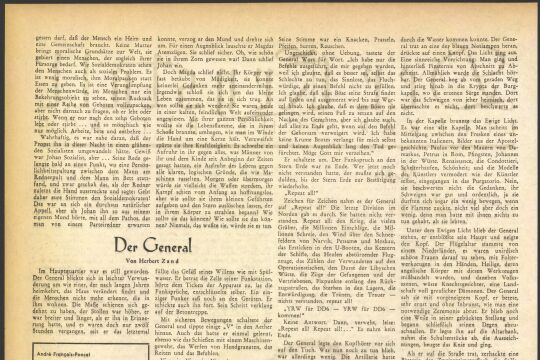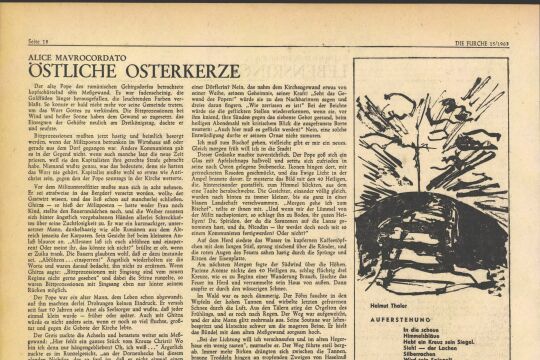Wenn gesagt wurde, hinter der Kette der Legionäre sei kein Mensch mehr gewesen, so ist das nicht ganz richtig. Ein Mensch war da, doch konnten nicht alle ihn sehen. Er saß auf dem Stein, der schwarzbärtige Mann mit den von Sonne und Schlaflosigkeit eiternden Augen, und ergab sich der Schwermut. Bald seufzte er, öffnete den auf seinen Wanderungen verschlissenen, ehemals blauen, jetzt schmutziggrauen Tallith und entblößte die von der Lanze geprellte Brust, über die schmutziger Schweiß lief, bald hob er in unerträglicher Qual die Augen zum Himmel und beobachtete die drei Geier, die seit langem hoch droben weite Kreise zogen im Vorgefühl des baldigen Festmahls, bald richtete er den hoffnungslosen Blick zur gelben Erde und starrte auf den halbzerfallenen Hundeschädel und die drumherum huschenden Eidechsen.
Seine Qual war so groß, daß er zeitweilig Selbstgespräche führte.
„Oh, ein Tor bin ich", murmelte er, wiegte sich gepeinigt auf dem Stein und zerkratzte mit den Nägeln die bräunliche Brust. „Ein Tor, ein hirnloses Weib, ein Feigling! Ein Kadaver bin ich, kein Mensch!"
Er verstummte, nickte, dann trank er aus der Holzflasche warmes Wasser, belebte sich wieder, griff bald nach dem Messer, das er unterm Tallith auf der Brust barg, bald nach dem Pergament, das zusamt einem Stöckchen und einem Tuschefläschchen vor ihm auf dem Stein lag.
Auf diesem Pergament stand bereits die Schrift:
„Die Minuten eilen, ich, Levi Matthäus, bin auf dem Schädelberg, und der Tod ist noch immer nicht eingetreten!"
Weiter:
„Die Sonne senkt sich, doch der ' Tod tritt nicht ein."
Jetzt schrieb Levi Matthäus mit dem zugespitzten Stöckchen mutlos:
„Gott! Wofür zürnst du ihm?. Schicke ihm den Tod." Dies geschrieben, schluchzte er trocken auf und kratzte sich abermals die Brust blutig.
Als die vierte Stunde der Hinrichtung verflossen war, erreichten Levis Qualen den höchsten Grad, und fürchterlicher Grimm befiel ihn. Er verfluchte sich, schrie sinnlose Worte hinaus, brüllte und spuckte aus und schmähte Vater und Mutter, die ihn als Dummkopf in die Welt gesetzt hätten.
Als er sah, daß seine Flüche und Schmähreden keine Wirkung hatten und in der Sonnenglut alles beim alten blieb, ballte er die sehnigen Fäuste, schwang sie mit verkniffenem Gesicht zum Himmel, gegen die Sonne, die immer tiefer herabkroch, die Schatten verlängerte und sich entfernte, um ins Mittelmeer zu stürzen, und forderte von Gott ein sofortiges Wunder. Er verlangte, Gott solle Jeschua alsbald den Tod schik-ken.
Als er die Augen öffnete, sah er, daß auf dem Hügel die Dinge unverändert und nur die grellen Flecke auf der Brust des Zenturi-os erloschen waren. Die Sonne sandte ihre Strahlen auf die Rücken der Gerichteten, die mit den Gesichern nach Jerschalaim blickten. Da schrie Levi:
„Ich verfluche dich, Gott!"
Mit heiserer Stimme schrie er, er wisse jetzt um Gottes Ungerechtigkeit und wolle ihm nicht mehr glauben.
„Taub bist du!" brüllte Levi. „Denn wärst du nicht taub, so würdest du mich hören und ihn sofort töten."
Mit verkniffenem Gesicht wartete Levi auf den Feuer strahl, der vom Himmel auf ihn fallen und ihn niederschmettern würde. Doch der Feuerstrahl blieb aus, und Levi fuhr fort, mit geschlossenen Augen giftige Schmähreden gen Himmel zu schreien. Er schrie, Wie grenzenlos enttäuscht er sei und daß auch noch andere Götter und Religionen existierten. Ja, ein anderer Gott hätte niemals zugelassen, daß ein Mensch wie Jeschua am Pfahl von der Sonne verbrannt würde.
In diesem Moment blies dem ehemaligen Zöllner etwas ins Gesicht, und zu seinen Füßen raschelte es. Als es nochmals blies, schlug er die Augen auf und sah, daß sich die Welt, sei es unterm Einfluß seiner Verwünschungen oder aus anderen Gründen, verändert hatte. Die Sonne war verschwunden, ohne das Meer erreicht zu haben, in dem sie allabendlich versank. Sie war verschluckt worden von einer dräuenden Gewitterwolke, die stetig von Westen her heraufzog. Ihre Ränder brodelten schon in weißem Gischt, und ihr schwarzer Qualmbauch flackerte gelblich. In ihr grummelte es, und von Zeit zu Zeit zuckten Feuerfäden hervor. Uber die Jaffastraße, durch das kärgliche Gihon-Tal, über die Zelte der Pilger flogen, vom plötzlichen Wind getrieben, Staubsäulen dahin. Levi verstummte und grübelte, ob das Gewitter, das Jerschalaim gleich zudecken würde, im Schicksal des unglücklichen Jeschua eine Wende bringen mochte. Er blickte auf die Feuerfäden, die die Wolke zerschnitten, und flehte, ein Blitz möge Jeschuas Pfahl treffen.
Levi richtete den Blick zum Fuß des Hügels, starrte dorthin, wo verstreut die Kavallerie-ala stand, und sah deutlich, daß dort bedeutende Veränderungen vor sich gegangen waren. Hastig rissen die Soldaten die Lanzen aus der Erde, warfen die Umhänge über, die Pferdewärter kamen zur Straße gelaufen und führten die Rappen am Zügel. Die Ala wurde zurückgezogen, soviel war sicher. Levi schirmte das Gesicht mit der Hand vor dem peitschenden Staub, spuckte aus und bemühte sich zu ergründen, was der Abzug der Kavallerie bedeutete. Als er weiter nach oben blickte, sah er eine kleine Gestalt in purpurner Soldatenchlamys zur Richtstätte hinaufsteigen. Im Vorgefühl eines glücklichen Endes stockte dem ehemaligen Zöllner das Herz.
Der Mann, der in der fünften Leidensstunde der Verbrecher den Berg hinaufstieg, war der in Begleitung eines Melders aus Jerschalaim herbeigesprengte Kommandeur der Kohorte. Auf einen Wink des Rattenschlächters öffnete sich die Kette der Soldaten, und der Zenturio salutierte dem Tribunen. Dieser nahm den Rattenschlächter beiseite und flüsterte ihm etwas zu. Der Zenturio salutierte abermals und trat auf die Henkergruppe zu, die zu Füßen der Pfähle auf Steinen saß. Der Tribun seinerseits lenkte seine Schritte zu dem Mann auf dem dreibeinigen Schemel. Dieser erhob sich höflich. Leise sprach der Tribun auf ihn ein, dann gingen die beiden zu den Pfählen.
Einen Bück voller Abscheu warf der Rattenschlächter auf die schmutzigen Lumpen am Fuß der Pfähle, die ehemaligen Kleider der Verbrecher, die die Henker verschmäht hatten, rief zwei der letzteren zu sich und befahl: „Folgt mir!"
Vom nächstgelegenen Pfahl tönte ein heiseres, sinnloses Lied. Der hier hängende Gestas hatte drei Stunden nach der Hinrichtung infolge der Fliegen und der Sonne den Verstand verloren, und jetzt sang er von Weintrauben, aber sein Kopf mit dem Turban bewegte sich noch ab und zu, dann erhoben sich die Fliegen träge von seinem Gesicht und ließen sich gleich erneut darauf nieder. Dismas am zweiten Pfahl litt noch mehr als die anderen, denn er war bei Bewußtsein und bewegte den Kopf rhythmisch nach rechts und links, um das Ohr gegen die Schulter zu stoßen. Glücklicher als die beiden war Jeschua. Schon in der ersten Stunde hatte ihn mehrmals das Bewußtsein verlassen, dann war er gänzlich in Ohnmacht gesunken, und sein Kopf im aufgelösten Turban hing herab.
Einer der Henker ergriff, dem Wink des Mannes mit der Kapuze gehorchend, eine Lanze, der andere brachte einen Eimer und einen Schwamm zum Pfahl. Der erste Henker stieß mit der Lanze erst gegen den einen, dann gegen den anderen gestreckten Arm Jeschuas, die mit Stricken an die Querbalken des Pfahls geschnürt waren. Ein Zucken ging durch den Körper mit den vortretenden Rippen. Der Henker führte das Speerende über Jeschuas Bauch. Da hob dieser den Kopf, zwang die verklebten Lider auseinander und blickte hinab. Seine Augen, früher klar, waren jetzt trüb. Er bewegte die geschwollenen Lippen:
„Was willst du? Warum bist du zu mir gekommen?"
„Trink!" sagte der Henker, und der wassergetränkte Schwamm auf der Speerspitze näherte sich Jeschuas Lippen. In dessen Augen blinkte Freude, er brachte die Lippen an den Schwamm und saugte gierig die Feuchtigkeit. Vom Nebenpfahl drang die Stimme des Dismas:
„Ungerecht! Ich bin genauso ein Verbrecher wie er!"
Dismas spannte sich, aber er konnte sich nicht bewegen, seine Arme waren an drei Stellen an den Querbalken geschnürt. Er zog den Bauch ein, krallte die Nägel in den Querbalken und wandte den Kopf zum Pfahl Jeschuas, und Wut loderte in seinen Augen.
Jeschua riß die Lippen vom Schwamm, er wollte, daß seine Stimme freundlich und überzeugend klang, doch es gelang ihm nicht, sie klang heiser, als er den Henker bat:
„Gib ihm zu trinken!"
Es wurde immer dunkler. Die Wolke überzog schon den halben Himmel und eilte gen Jerschalaim, kochende weiße Wölkchen flogen der von Feuer und schwarzer Nässe erfüllten Gewitterwolke voraus. Direkt überm Schädelberg blitzte und donnerte es. Der Henker nahm den Schwamm vom Speer.
„Preise den großmütigen Hegemon!" flüsterte er feierlich und stieß Jeschua sanft den Speer ins Herz.
Beim zweiten Donnerschlag hatte der Henker auch Dismas getränkt und ihn mit denselben Worten „Preise den Hegemon!" getötet.
Gestas, der nicht mehr denken konnte, schrie erschrocken auf, als der Henker vor ihm stand, doch sowie der Schwamm seine Lippen berührte, schlug er brüllend die Zähne hinein. Gleich darauf hing auch sein Körper schlaff in den Stricken.
Der Mann mit der Kapuze folgte dem Henker und dem Zenturio, und hinter ihm ging der Chef der Tempelwache. Beim ersten Pfahl blieb der Mann mit der Kapuze stehen, betrachtete aufmerksam den blutüberströmten Jeschua, berührte mit weißer Hand dessen Fuß und sagte zu seinen Begleitern: „Er ist tot."
Das gleiche wiederholte sich bei den anderen Pfählen.
Danach gab der Tribun dem Zenturio ein Zeichen, wandte sich ab und stieg mit dem Chef der Tempelwache und dem Mann mit der Kapuze den Berg hinunter. Es war schon sehr dunkel, Blitze furchten den schwarzen Himmel. Plötzlich spritzte Feuer aus ihm hervor, und der Ruf des Zenturios „Die Kette zurückziehen!" ging im Donner unter. Die Soldaten stürmten glücklich den Berg hinab und setzten im Laufen die Helme auf. Finsternis verhüllte Jerschalaim.
Plötzlich flutete ein Platzregen • herab und erreichte die Zenturien auf halber Höhe des Berges. So dicht strömte das Wasser hernieder, daß den abwärts laufenden Soldaten bereits tobende Wassef-wogen hinter drein jagten. Sie glitten aus, stürzten auf dem zerweichten Lehm und beeilten sich, die glatte Straße zu erreichen, auf der, durch den niederprasselnden Regen kaum zu sehen, die völlig durchnäßte Kavallerie gen Jerschalaim sprengte. Nach wenigen Minuten befand sich auf dem Hügel mitten in der Brühe aus Donner, Wasser und Feuer nur noch ein Mensch. Das doch nicht sinnlos gestohlene Messer schwenkend, von schlüpfrigen Vorsprüngen abrutschend, an alles sich klammernd und manchmal auf allen vieren kriechend, strebte Levi den Pfählen zu. Mal verschwand er in der dichten Finsternis, mal beleuchtete ihn das zuckende Licht.
Bis an die Knöchel im Wasser watend, erreichte er die Pfähle, hier riß er sich den regenschweren Tallith herunter und schmiegte sich im bloßen Hemd an Jeschuas Füße. Erst zerschnitt er die Strik-ke an den Knöcheln, dann stieg er auf den unteren Querbalken, umfing Jeschua und befreite dessen Arme von der oberen Verschnürung. Der nasse, nackte Körper stürzte auf ihn herab und warf ihn zu Boden. Levi wollte ihn sich auf die Schultern laden, doch da kam ihm ein Gedanke. Er ließ den Körper mit dem zurückgebogenen Kopf und den ausgestreckten Armen im Wasser liegen und lief, im glitschigen Lehm ausrutschend, zu den anderen Pfählen. Auch hier zerschnitt er die Stricke, und die beiden Körper fielen zu Boden.
Wenig später befanden sich auf dem Gipfel nur noch die beiden Leichname und die drei leeren Pfähle. Das Wasser stieß die Körper und bewegte sie.
Levi und Jeschuas Körper waren nicht mehr auf dem Schädelberg.
Leicht gekürzt aus dem Roman „Der Meister und Margarita" von Michail Bulgakow (1891-1940), deutsch im Verlag Styria, Graz.