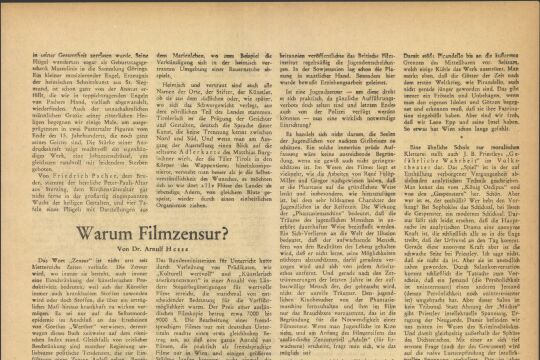Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Surrealist im Biedermeier
Es ist hundertfünfzig Jahre her, daß Ferdinand Raimund seinem Leben ein Ende gesetzt hat, was ja nicht nur als Zeichen seiner Tragik oder gar einer Sinnesverwirrung zu betrachten ist, sondern als ein letztes Aufbäumen der Vitalität gegen den Wienerischen Zustand, weder anständig leben noch anständig sterben zu können, sondern im Zwischenbereich zwischen Leben und Tod dahinzuvegetieren, die eigene Herzenskälte mit andauerndem herzlichen Schnick-Schnack kaschierend.
Raimund und Wien, das ist ein eigenes Thema: Wie eine Stadt immer ausgerechnet ihr jeweiliges Genie frißt. All diese Jahrzehnte auf der Bühne zu überdauern, ist keine Kleinigkeit, und dabei in dieser bezaubernden Frische, so daß uns jede kleine Szene, jede beklemmende Wendung der dramatischen Handlung und dann jede beglückende Auflösung, ja selbst noch jede Verlegenheitslösung erwärmende Freude bereitet! Auch darin hegt Raimunds große Vitalität. Er ist so völlig unbekümmert, wenn es darum geht, einen Gedanken in eine Allegorie und eine Allegorie in eine Fabel zu verwandeln und diese Fabel dann mit verteilten Rollen auf die Bühne zu bringen,und zwar so, daß die Figuren auch noch Charaktere sein sollen; und zwar menschliche, das heißt: Charaktere, die zwar in der Wirklichkeit stehen, aber von dieser weder besessen noch auch eigentlich geformt sind.
Diese Deutung des Charakters ist Raimunds barockes Erbe. Seine halb realistischen, halb phantastischen Charaktere reflektieren den menschlichen Zustand, wie er vor seiner Entmenschlichung gewesen ist.
Die explosive Entwicklung der Technik und mit ihr das Entstehen einer verdummend arbeitsteiligen, bis zur Entfremdung durchindustrialisierten, das körperliche Wohl um den Preis der geistigen Misere fördernden Massengesellschaft hat in der Literatur einen platten Verismus hervorgebracht. Er ist lügnerisch, da er den Menschen auf eine einzige, nämlich auf seine leiblich-soziale Komponente reduziert. Er ist korrupt, da er sich allein nach der Nachfrage des Marktes richtet. Und er ist gefährlich, weil er glauben machen will, daß diese kümmerliche Reduzierung, dieser bornierte Verfall in einen Aberglauben tatsächlich ein dauerhafter, wünschenswerter, ja utopischer Zustand sein könnte.
Gerade diejenigen Autoren, die den platten Realismus überwinden, fühlen sich aus diesem Grunde als späte, durch Mitfühlen und noch mehr durch die Analogie des Strebens zur Wahlverwandtschaft berechtigte Jünger Ferdinand Raimunds.
Der Gleichklang, der sich hier sozusagen über das veristische Zeitalter hinweg ergeben mag (etwa so wie die Harmonie zwischen der Generation der Großväter und der der Enkel), besteht freilich aus mehreren Tönen.
Wo hegt die wichtigste und natürlichste Ubereinstimmung? Im Vertrauen auf die Souveränität des Spieles; in der Uberzeugung, die Bühnenwelt büde einen eigenen Kosmos, dessen Realität gegaukelt, dessen Gaukelei aber Realität ist. Hier kann alles möglich sein, denn die Dialektik der Notwendigkeiten entwickelt sich —jedesmal aus der Inspiration des Augenblicks — vor unseren Augen, so daß unter anderem auch die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Märchenwelt aufgehoben werden können. Pirandellos „Heinrich IV.“ zeigt ebenso die zauberische Mechanik dieser Dramaturgie wie Molnärs „Olympia“.
Ja, worin bestehen denn überhaupt diese Grenzen? Ist die Wirklichkeit — im Spiel auf der Bühne — vielleicht kein Märchen? Und ist das Märchen, gerade dadurch, daß es sich auf einer Bühne wahrhaftig ab-spielt, nicht Wirklichkeit?
Kaum weniger wichtig ist eine andere Analogie.
Während wir dabei sind, den Verismus zu überwinden, besinnen wir uns wieder jener ursprünglichen Bilder einer menschlichen Komplettheit, die zwar von verschiedenen Betrachtern je nach innerer Einstellung verschieden deutbar, jedoch überall in irgendeiner Weise verständlich, vielsagend, ja nicht selten heüsam waren. Durch die Forschungen von C. G. Jung sind die Archetypen in ihrer Lebendigkeit erschlossen worden. Eines der wichtigsten Schauspiele deutscher Zunge, „Biograf ie“ von Max Frisch, hätte ohne die Besinnung auf den Archetypus (und auf die ihn umgebende offene Märchenwelt) ebenso wenig entstehen können wie die Stücke von Samuel Beckett. Die Figuren von „Warten auf Godot“ sind Bewohner des selben gnadenlosen und zugleich barmherzigen, also absurden Wunderlandes wie der Alpenkönig und der Menschenfeind. Man wünschte sich, sämtliche deutsche Dichter studierten dieses Werk von Raimund, um einzusehen, daß nicht in der Idee die Aufgabe der Kunst liegt, sondern in der Belebung der Idee, daß die Poesie Wesen und Anschauung will, nicht abgeschattete Begriffe. Diesen letzten Satz hat, fast wörtlich, Grillparzer geschrieben, im Jahre 1837.
Das heißt: Die Parabel ist wichtiger als die Realität, die Phantasie hat Vorrang vor jedem Versuch, etwas zu rekonstruieren oder gar zu kopieren, und das Recht des Menschen auf ein eigenes Schicksal ist um eine winzigste Spur stärker als seine Bindungen an den eigenen Leib und an die eigene gesellschaftliche Existenz. In dieser winzigsten Spur liegt des Menschen einzige wirkliche Chance.
Ferdinand Raimund ist ein Exi-stentialist des Biedermeiers. Er steht in der Weltliteratur nicht allein; aus seiner näheren und weiteren Nachbarschaft blicken Gogol, E. T. A. Hoffmann, E. A. Poe zu uns hinüber. Allein steht er jedoch auf den österreichischen Bühnen: gespielt, zum Teil geliebt, ganz und gar unverstanden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!