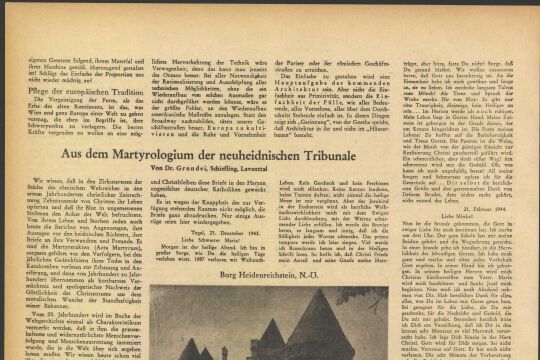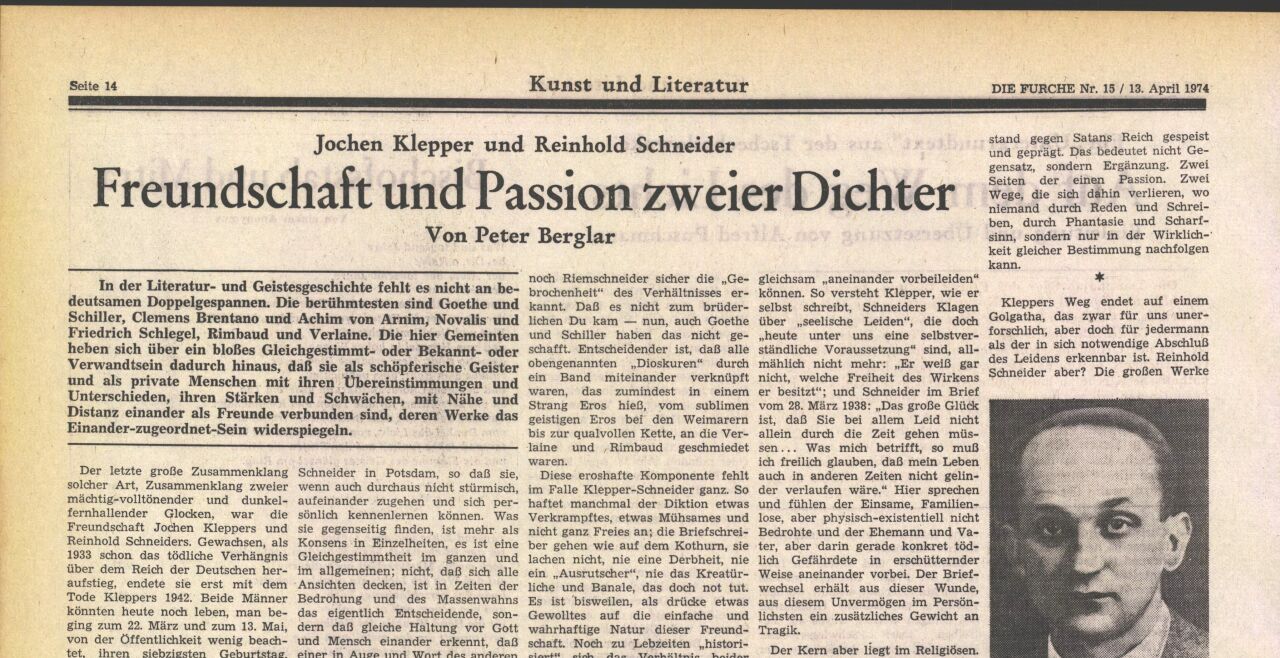
Freundschaft und Passion zweier Dichter
In der Literatur- und Geistesgeschichte fehlt es nicht an bedeutsamen Doppelgespannen. Die berühmtesten sind Goethe und Schiller, Clemens Brentano und Achim von Arnim, Novalis und Friedrich Schlegel, Rimbaud und Verlaine. Die hier Gemeinten heben sich über ein bloßes Gleichgestimmt- oder Bekannt- oder Verwandtsein dadurch hinaus, daß sie als schöpferische Geister und als private Menschen mit ihren Ubereinstimmungen und Unterschieden, ihren Stärken und Schwächen, mit Nähe und Distanz einander als Freunde verbunden sind, deren Werke das Einander-zugeordnet-Sein widerspiegeln.
In der Literatur- und Geistesgeschichte fehlt es nicht an bedeutsamen Doppelgespannen. Die berühmtesten sind Goethe und Schiller, Clemens Brentano und Achim von Arnim, Novalis und Friedrich Schlegel, Rimbaud und Verlaine. Die hier Gemeinten heben sich über ein bloßes Gleichgestimmt- oder Bekannt- oder Verwandtsein dadurch hinaus, daß sie als schöpferische Geister und als private Menschen mit ihren Ubereinstimmungen und Unterschieden, ihren Stärken und Schwächen, mit Nähe und Distanz einander als Freunde verbunden sind, deren Werke das Einander-zugeordnet-Sein widerspiegeln.
Der letzte große Zusammenklang solcher Art, Zusammenklang zweier mächtig-volltönender und dunkel-fernhallender Glocken, war die Freundschaft Jochen Kleppers und Reinhold Schneiders. Gewachsen, als 1933 schon das tödliche Verhängnis über dem Reich der Deutschen heraufstieg, endete sie erst mit dem Tode Kleppers 1942. Beide Männer könnten heute noch leben, man beging zum 22. März und zum 13. Mai, von der Öffentlichkeit wenig beachtet, ihren siebzigsten Geburtstag. Daß beide nicht mehr leben und schaffen, bedeutet zwar unendlichen Verlust, einen Fehlposten im verwirrten geistigen Haushalt der Nation, aber ihr Fortgang war Zeichen, gesetzt zur rechten Stunde. Denn Jochen Klepper und Reinhold Schneider lebten, arbeiteten und starben als Zeugen zu der Stunde, da das Zeugnis gebraucht wurde und gegeben werden mußte, um in die Zukunft wirken zu können. Daß sie in der Nacht Deutschlands da waren und ein Licht trugen und hüteten, daß Klepper in dieser Nacht unterging, als sie am finstersten schien, und daß Reinhold Schneider an der Schwelle zu einer neuen Finsternis starb, die damals, 1958, fast nur er gewahrte, die er als die alte, nur von künstlichem Licht erhellte durchschaute, das gehört zu den Gnadenerweisen des Herrn der Geschichte.
Wir besitzen zwei eindrucksvolle Quellen hierzu; es ist der Briefwechsel Jochen Kleppers 1925—1942, mustergültig herausgegeben von Ernst G. Riemschneider (Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1973), an taktvoller und kenntnisreicher Kommentierung, an Differenzierungsvermögen kaum übertreffbar. Dessen Herzstück ist der Briefwechsel mit Schneider; und es ist Ingo Zimmermanns Studie „Der späte Reinhold Schneider“ (Herder, Freiburg/Basel/ Wien 1973), die letzte Fragen einer Christen-Existenz in unserem Jahrhundert bewußtzumachen unternimmt.
Die Korrespondenz der beiden Dichter beginnt mit einem Brief Kleppers vom 19. April 1934, in dem er, selbst an seinem Friedrich-Wilhelm-Roman „Der Vater“ arbeitend, seine tiefe Berührtheit von Schneiders ein Jahr zuvor erschienenem Buch „Die Hohenzollern“ ausspricht. Gleich dieser erste Brief macht Kleppers Tagebucheintragung vom 9. Mai verständlich: „Dieser Mensch... ist mir Schicksal geworden.“ Denn, so formuliert es der Schreiber, „während wir anderen etwa gleichaltrigen Schriftsteller unsere Zeit und einen falschen Ehrgeiz in Funk und Presse und Film vertan haben, schrieben Sie ein Buch, das zehnmal zeitgemäßer ist als alle Artikel und ungleich mehr Bestand haben muß. Es fällt einem wieder einmal wie Schuppen von den Augen, was ein Schriftsteller zu tun und wonach er nicht zu fragen hat.“
Zwei Männer, dreißigjährig, finden zueinander durch das Ja zu einer Themensphäre, die zugleich Denk-und Gefühlssphäre und ihnen beiden, ohne daß sie es schon voll erfassen, gemeinsam ist, durch ein Ja, das auch ein Nein zum herrschenden Zeitgeist einschließt. Beide leben zudem nicht nur geistig, sondern auch geographisch im selben historischen Raum, Klepper in Berlin, Schneider in Potsdam, so daß sie, wenn auch durchaus nicht stürmisch, aufeinander zugehen und sich persönlich kennenlernen können. Was sie gegenseitig finden, ist mehr als Konsens in Einzelheiten, es ist eine Gleichgestimmtheit im ganzen und im allgemeinen; nicht, daß sich alle Ansichten decken, ist in Zeiten der Bedrohung und des Massenwahns das eigentlich Entscheidende, sondern daß gleiche Haltung vor Gott und Mensch einander erkennt, daß einer in Auge und Wort des anderen die eigene Wertordnung geteilt findet. Klepper und Schneider antworten der Zeit nicht durch ihr „Dage-gen-Sein“, sondern durch ihr An-ders-Sein.
In das Klepper überreichte Buch „Philipp der Zweite oder Religion und Macht“ schreibt der Autor: „Jochen Klepper im Namen der Ordnung auf Erden und im Vertrauen auf seine Kunst herzlich zugeeignet Reinhold Schneider.“ Ein Bekenntnis der Freundschaft: tief und klar den Grund der Dinge und beider Gesetz nennend. „Im Namen der Ordnung auf Erden“, das ist nicht Agitatorenrezept, sondern der Glaube bekennt das Sich-Verhüllen und das Sich-Enthüllen des Kreuzes als das Geheimnis der Geschichte. Hierin verstand der evangelische Christ Klepper den katholischen Christen Schneider ganz. Seine eigenen „Königsgedichte“, die er im September 1935 geschrieben und dem Freund als einem der ersten gegeben hatte, verkündeten gerade diese Ordnung auf Erden. Auf diese Gedichte auch und auf das im Vorabdruck erschienene erste Kapitel aus „Der Vater“ konnte sich Schneider beziehen, wenn er vom Vertrauen auf des Gefährten Kunst sprach.
Dieses Vertrauen hatte sich gleich anfangs in der Kritik an einem unter dem Titel „Die Königsstadt“ veröffentlichten Romankapitel bewährt. Sie richtet sich gegen eine gewisse modische Manier der Sprach-Zer-hackung nach expressionistischem Muster: „Sie verwenden in dem Bestreben, viel auf das knappste zu sagen, einzelne Worte an der Stelle ganzer Sätze. Nun widerspricht das der guten Tradition unserer Prosa, aber auch dem schönen, ehrfürchtigen Geist Ihres Buches ...“ Schneider wagte die Kritik gegenüber dem ihm noch kaum Bekannten, weil er ihn ernst nahm, und der Kritisierte, sonst sehr empfindlich, verstand, daß er ernstgenommen wurde. Dieser Zug der wechselseitigen Teilhabe an der Arbeit, am mühseligen Handwerk, der ein Kennzeichen jedes Bundes schöpferischer Menschen ist, eignete von Anfang an und bis zum Schluß dem Bündnis der Dichter: die Bewährung im Tätig-Praktischen, im Alltag des NS-Staates mit Kampf um Druckerlaubnis, mit Gesuchen an die Reichsschrifttumskammer, mit Kampf um Papierzuteilung, mit Sich-Mühen um Verleger, um Rezensionen, um Unterbringung von Aufsätzen — ein zäher Kleinkrieg, um nicht erstickt und totgeschwiegen zu werden. Die Briefe belegen das alles, und sie zeigen insbesondere Reinhold Schneider als den unermüdlich Getreuen, denn seine Verbindungen sind weiter verzweigt, ohne Familie und wenigstens rassisch nicht bedrängt, kann er sich doch noch etwas freier regen als der Freund.
Obwohl es in der sich über acht Jahre erstreckenden Korrespondenz nicht an Bekundungen der rein menschlichen Zuneigung und der Warmherzigkeit fehlt, so hat dennoch Riemschneider sicher die „Gebrochenheit“ des Verhältnisses erkannt. Daß es nicht zum brüderlichen Du kam — nun, auch Goethe und Schiller haben das nicht geschafft. Entscheidender ist, daß alle obengenannten „Dioskuren“ durch ein Band miteinander verknüpft waren, das zumindest in einem Strang Eros hieß, vom sublimen geistigen Eros bei den Weimarern bis zur qualvollen Kette, an die Verlaine und , Rimbaud geschmiedet waren.
Diese eroshafte Komponente fehlt im Falle Klepper-Schneider ganz. So haftet manchmal der Diktion etwas Verkrampftes, etwas Mühsames und nicht ganz Freies an; die Brief Schreiber gehen wie auf dem Kothurn, sie lachen nicht, nie eine Derbheit, nie ein „Ausrutscher“, nie das Kreatür-liche und Banale, das doch not tut. Es ist bisweilen, als drücke etwas Gewolltes auf die einfache und wahrhaftige Natur dieser Freundschaft. Noch zu Lebzeiten „historisiert“ sich das Verhältnis beider Männer zueinander. Sie wurden durch das gemeinsame Erleiden der Nacht über Deutschland und der Welt zu Weggefährten, aber es bleibt eine gläserne Wand zwischen ihnen. Und sie beginnt sogar ganz allmählich sich zu beschlagen. Viele kleine und größere Liebesdienste vermögen daran nichts zu ändern.
Wohl sind die Freunde einander tief verbunden — „... wie völlig verstehen wir einander in ganz wenigen Worten, im Hinblick auf Kirche, Staat, Privatleben, Kunst, Geschichte in einem“, notiert Klepper in sein Tagebuch, aber dort ist auch die Wandlung bezeugt: „...ich spüre deutlich, daß mein Verhältnis zu ihm nur von Vergangenheit lebt...“
Es ist bedrückend zu sehen, daß Menschen, die sich nahestehen, doch gleichsam „aneinander vorbeileiden“ können. So versteht Klepper, wie er selbst schreibt, Schneiders Klagen über „seelische Leiden“, die doch „heute unter uns eine selbstverständliche Voraussetzung“ sind, allmählich nicht mehr: „Er weiß gar nicht, welche Freiheit des Wirkens er besitzt“; und Schneider im Brief vom 28. März 1938: „Das große Glück ist, daß Sie bei allem Leid nicht allein durch die Zeit gehen müssen ... Was mich betrifft, so muß ich freilich glauben, daß mein Leben auch in anderen Zeiten nicht gelinder verlaufen wäre.“ Hier sprechen und fühlen der Einsame, Familienlose, aber physisch-existentiell nicht Bedrohte und der Ehemann und Vater, aber darin gerade konkret tödlich Gefährdete in erschütternder Weise aneinander vorbei. Der Briefwechsel erhält aus dieser Wunde, aus diesem Unvermögen im Persönlichsten ein zusätzliches Gewicht an Tragik.
Der Kern aber liegt im Religiösen. Dem evangelischen Klepper, dem Pfarrerssohn, der von 1922 bis 1926 Theologie studierte, ist auch der Staat Adolf Hitlers eine von Gott verhängte, eine zugelassene Obrigkeit. Er denkt nicht an Aktion, nicht an Widerstand. Der Christ hat die Despotie zu erdulden; es führen ohnehin alle Wege nach Golgatha. Klepper duldet stumm, nicht so sehr intellektuell oder historisch passioniert als vielmehr ganz realistisch in der entsetzlichen, nie aufhörenden, sich wie eine Schlinge um den Hals legenden Angst vor der Vernichtung seiner jüdischen Frau und seiner jüdischen Stieftochter. Alles bloß Weltanschauliche, Theoretische, Aktionistische wird ausgeglüht, unerbittlich hingetrieben auf die letzte Frage von Leben und Tod: Hiob sein, Hiobschicksal annehmen, das äußerste Leid, die Abholung und Tötung von Tochter und Ehefrau mitansehen oder handeln wie Ruth: „Wo du hingehst, da will ich aufch hingehen.“ Ein unauslotbarer, den Kern der Seele treffender Konflikt auf der Bühne der schrecklichsten Realität.
Am 11. Dezember 1942, nachdem alle Wege zur Rettung erschöpft waren, schied Klepper mit seiner Frau Hänni und der Tochter Renate aus dem Leben. Reinhold Schneider hat ihn um mehr als fünfzehn Jahre überlebt. Ihm war noch vergönnt, Bedeutendes zu sagen, Wirkung in die Breite schien einzusetzen, Ehrungen kamen, die nach zwölfjährigem Stau anflutende Woge der Freiheit, der Erneuerung, der Wiedergutmachung.
Es wäre unnatürlich, wenn es ihm nicht manchmal gutgetan hätte; in dem Jahrzehnt zwischen 1945 und' 1955 schien den Deutschen endlich ihr großer christlicher Dichter des Jahrhunderts geschenkt zu sein, und sie schienen das zu begreifen. Und doch: niemand ließ sich davon weniger blenden als er, niemand schaute durch alles Getriebe, alle Fassaden, alles Marktgewimmel tiefer hindurch als er. Er sah in Abgründe. Ingo Zimmermanns Studie tastet sich ehrfurchtsvoll und doch immer wissenschaftlich genau an jenen Reinhold Schneider heran, der nicht nur der „späte“, sondern der geheimnisvolle Reinhold Schneider ist. Der schmale Band führt an Fragen heran, die ihren Wert in sich, nicht in einer schlüssigen Antwort haben, welche noch, oder sogar für immer, unmöglich ist.
Tragisches Lebensgefühl, Geschichte als persönlicher Kreuzweg, Deus absconditus bei Schneider? Das Evangelium, der Glaube Luthers, das Gottvertraueh bei Klepper? Beider Dichter Werk stand unter dem Kreuz, dem ihren, dem Deutschlands, dem der Welt; beider Werk entfaltete sich in der Nacht gegen den Geist der Zeit, gegen den Druck der Macht. Vielleicht war Kleppers Schaffen mehr von der Ergebung in Gottes Willen, das Schaffen Schneiders mehr vom Widerstand gegen Satans Reich gespeist und geprägt. Das bedeutet nicht Gegensatz, sondern Ergänzung. Zwei Seiten der einen Passion. Zwei Wege, die sich dahin verlieren, wo niemand durch Reden und Schreiben, durch Phantasie und Scharfsinn, sondern nur in der Wirklichkeit gleicher Bestimmung nachfolgen kann.
Kleppers Weg endet auf einem Golgatha, das zwar für uns uner-forschlich, aber doch für jedermann als der in sich notwendige Abschluß des Leidens erkennbar ist. Reinhold Schneider aber? Die großen Werke des Dichters waren geschrieben, „Die Hohenzollern“, „Philipp der Zweite“, „Das Inselreich“, „Las Casas'', Frucht eines großen Kampfes, Antworten in einer zwar schrecklichen, aber in ihrer Schrecklichkeit bestimmbaren historischen Situation. Er war gegen Ende des Regimes zunehmenden Verfolgungen ausgesetzt, aber der Feind war bekannt und beim Namen zu nennen. Doch nun?
1945 endete der Krieg, aber es kam kein Frieden, der Nacht folgte kein Tag, sondern ein Wechsel volles Grau: Freund und Feind, Wahrheit und Lüge, Recht und Unrecht, Glaube und Unglaube verloren die Konturen, waren noch viel weniger auszumachen und abzugrenzen als vorher. Ruinen im ganzen Land — und Schneider erlebte noch, wie sie wiederaufgebaut wurden, ersetzt durch die konfektionierten Gehäuse der Produktions- und Konsumwelt. Trümmer ringsum, vor allem in den Menschen, Trümmer der Ordnung, der Werte, der Gefühle in jeder einzelnen Seele — und Schneider erlebte noch, wie sie zermahlen wurden zum zähen Mörtelbrei der Indifferenz und des Opportunismus, der den Neubau zusammenhalten soll.
Jetzt erst erfuhr Schneider das Martyrium der gänzlichen Ohnmacht. Einer Ohnmacht im allerletzten Sinne. Gott zog sich zurück. Er „verbarg“ sich ihm nicht nur, was einschlösse, daß er „hinter der Wolkenwand“ noch gewußt wird. Die grauenvolle Leere des Nichts ließ Schneider in seinen letzten Jahren erstarren, in Entsetzen verstummen. „Winter in Wien“ ist das Buch dieses zu Worten geronnenen Verstummens. Die Deutschen, vor allem die katholischen, hatten „ihren“ Dichter zu besitzen gemeint, hatten ihn gefeiert, seine Bücher gekauft und gelesen. Aber dieser Dichter, der „über“ Gott und Kirche und Geschichte sprach und schrieb, starb in einem langen, qualvollen, eisigen Alleinsein, aus dem kein Werk, keine Ehrung, nicht Liebe und Freundschaft, sondern nur der Tod erlösen konnte.
Wer vermöchte den Leidensweg Jochen Kleppers und Reinhold Schneiders gegeneinander zu wägen? Nur daß sie ihn gingen und daß sie Zeugnis gaben, zählt.