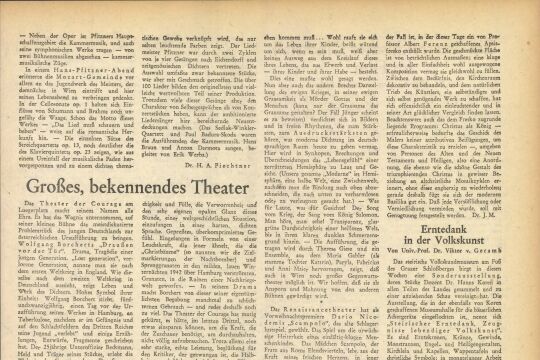Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gestern — Heute
Der Blick auf die Vergangenheit läßt uns den entscheidenden Unterschied zur Gegenwart erkennen. Das Wien des leichtlebigen führenden Bürgertums vor der Jahrhundertwende ersteht in dem Zyklus „Anatol“ von Arthur Schnitzler, .aus dem fünf der sieben Einakter derzeit im Akademietheater gespielt werden. Hinzu kommt die Uraufführung des Einakters „Süßes Mädel“, der aus der gleichen Zeit stammt. Drei Kleinbühnen bemühen sich, in krassem Gegensatz dazu, um heutige Perspektiven.
Der Blick auf die Vergangenheit läßt uns den entscheidenden Unterschied zur Gegenwart erkennen. Das Wien des leichtlebigen führenden Bürgertums vor der Jahrhundertwende ersteht in dem Zyklus „Anatol“ von Arthur Schnitzler, .aus dem fünf der sieben Einakter derzeit im Akademietheater gespielt werden. Hinzu kommt die Uraufführung des Einakters „Süßes Mädel“, der aus der gleichen Zeit stammt. Drei Kleinbühnen bemühen sich, in krassem Gegensatz dazu, um heutige Perspektiven.
Man braucht nur an das Wort „Sex“ zu denken, um zu erkennen, wie ganz anders dieser Anatol noch die Beziehung zu den Frauen erlebte. Da ist das Sinnliche noch nicht lediglich kaltschnäuzig funktionaler Vollzug. Zwar hütet sich Anatol vor wirklich hingebender Liebe wie vor zerstörender Leidenschaft, aber er sublimiert die Gefühle, die eine Liaison in ihm erwecken, er kostet sie aus, kultiviert sie, nimmt sie als einzigen kostbaren Lebensinihalt. Obwohl er es sich leisten kann, nichts zu tun, obwohl er imstande ist, allein im Erotischen melancholisch verklärte Erfüllung zu finden, sind diese Szenen auch heute noch spielbar. Steckt doch nocht etwas von Anatols Einstellung in uns? Oder sagen wir uns, daß diesem Fin de siecle des Sinnlichen mehr Schönheit eignet als dem heutigen Sex?
Der Einakter „Süßes Mädel“ führt die Situation solch eines Geschöpfs in einer wohl rasch vergehenden Beziehung vor. Als Anatol auf einen Ball gehen will, spürt diese Fritzi, die ihn innig liebt, schmerzlich den Abstand zu jener anderen gehobenen Welt, der sie nie angehören wird.
Wie sehr dieses Wien der Jahrhundertwende versunken ist, erweist sich an den beiden männlichen Hauptgestalten, die man, wie sich zeigt, nicht mehr voll deckend besetzen kann. Michael Heitau ist zwar unter der Regie von Gerhard Klingenberg als Anatol ein netter Kerl, aber die müde kultivierte Sinnlichkeit dieser Gestalt besitzt er nicht. Wolfgang Hübsch bleibt als sein Freund Max reichlich blaß. Dagegen kommen die Frauenrollen durch Dorothea Parton, Helga Papouschek, Aglaja Schmid, Johanna Matz, Gertraud Jesserer und Lotte Ledl zu guter Wirkung. Rouben Ter ArvXu-nian ließ den Bühnenraum verhalten mit Makartmotiven ausmalen und stellte Türen und Fenster isoliert als Versatzstücke auf den Bühnenboden. Franca Squarciapino entwarf zeitgerechte Kostüme.
Blick auf das Heute. Welche Lebensbereiche führt man da vor? Wie ist die Einstellung dazu? Das „Theater der Courage“ spielt abermals ein Stück von Franz Xaver Kroetz, und zwar „Dolomitenstadt Lienz“, eine angebliche Posse, die vor eineinhalb Jahren in Bochum zur Uraufführung gelangte. Wir hören da einen Abend lang, worüber sich drei Untersuchungsgefangene, im Bezirksgefängnis von Lienz wegen kleinerer Verbrechen festgehalten, aus Langeweile unterhalten. Daß auch Banalstes geringfügige psychologische Rückschlüsse ermöglicht, versteht sich von selbst, aber wozu? Dieser Naturalismus des Banalen ödet nur unsagbar an, erst potenziert Banales zieht den Blick in tiefere Schichten. Welch ein Unterschied zu Genets „Unter Aufsicht“! Als Posse bezeichnet Kroetz das Stück, weil es da Songs gibt. Welcher Unterschied zu denen Brechts! Die drei Häfenbrüder nimmt man Bertram MödXagl, Michael Gampe und Oskar Schuster unter der Regie von Peter Gruber durchaus ab. Weshalb wird das Stück aufgeführt? Laut Programmheft, weil uns klarwerden soll, daß unser derzeitiges gesellschaftliches System ein uns alle umfassendes „Gefängnis“ ist. Aha, wir — Betonung auf „wir“ — leben also ir einem Gefängnis, nicht die Bewohner der Terrorstaaten.
Das Zwei-Personen-Stück ,JDie Aufgabe“ von Hans Krendlesberger, voi aoht Jahren im „Kleinen Theater der Josefstadt“ uraufgeführt, ist nun in der „Tribüne“ zu sehen. Die drei Akte zeigen zwei weibliche Büroangestellte in Abständen von siebzehn und achtzehn Jahren an ihren Schreibtischen, wobei die Leere solch eines Daseins, die Sinnlosigkeit durch Uberdrehen der Realität sinnfällig gemacht wird: Sie schreiben all die Jahrzehnte hindurch ausschließlich Dankbriefe für Kondolenzen, die nach dem jeweiligen Tod von sieben Staatspräsidenten eintrafen. Die Archive benötigen mehr und mehr Raum, Stockwerk um Stockwerk muß aufgebaut werden, schließlich sind es 140. Die psychologische Auswirkung im sadomasochistischen Verhalten der beiden Frauenzimmer gibt eine gewiss^ Spannung, doch ist der Einfall — wie bei manchen ,Absurden“ — nicht abendfüllend, naturalistische Einschübe gehören nicht mehr dem initiierten Überdrehen zu. Die polnische Regisseurin Romana Pröch-nicka akzentuiert die Dialoge mehrfach durch mancherlei Abstruses. Die beiden Darstellerinnen Ingrid Burkhard und Inge Rosenberg bieten auch noch als Gealterte Intensität.
In den drei Einaktern des Tschechen Pavel Kohout, die unter dem Titel „Das Leben im stillen Haus“ von der „Werkstatt“ im Theater am Kärntnertor aufgeführt werden, geht es in leicht durchschaubarer Verschlüsselung gegen ein herrschendes terroristisches System. Selbstverständlich begibt sich nichts Stilles in diesem Mietshaus, im Gegenteil. „Brand“: Im Souterrain brechen bei einem jung vermählten Paar Feuerwehrleute nächtens wegen eines vorgeblichen Brandes ein und erzwingen den Abschluß einer für beide Teile gewinnbringenden Feuerversicherung. „Krieg“: Der im dritten Stock wohnende Rechtsanwalt Doktor Blaha erhält von einer unbekannten höhen Stelle den Befehl, gegen den ebenfalls von ihr ausgewählten Weinhändler Müller mit MP und Handgranaten Krieg zu führen. Kein Widerstreben hilft, beide fallen im Kampf. (Dieser Einakter wurde bereits im Akademietheater gespielt.) „Pech“:. Zu dem schüchternen jungen Maler in der Dachwohnung kommt nach vier Jahren erstmals die Angebetete, aber aus dem Schrank tritt plötzlich einer, der ihn als mutmaßlich zukünftigen Mörder zu beschatten hat. Er ein zukünftiger Mörder? Hirnrissige Vorstellung! Am Schluß ermordet er den Beschatter.
Kohout, der in seinem Land zum Schweigen verurteilt ist, spricht da eine sehr deutliche Sprache. Das Absurde hat in diesen Einaktern keine metaphysische Dimension, es ist da die nicht unmittelbar greifbare, aber sehr reale politische Macht, die durch servile Befehls-ausübende die Menschen manipuliert, in Verbrechen treibt. Kohout hat, im „Gefängnisstaat“ lebend, den Mut, Terroristisches leicht verkraust anzuprangern. Durch den freien Westen wird es publik. Unter der Regie von Hans Gratzer ersteht vor allem mit Paul Weismann und Toni Böhm, mit Bernd Spitzer, Emmy Werner und Roger Murbach eine Aufführung von mitreißender Lebendigkeit und Schlagkraft. Auf einer erhöhten, matratzenibelegten Spielfläche mit Eisengerüsten an zwei Seiten — Entwurf Peter Giljum — turbulieren die Vorgänge.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!