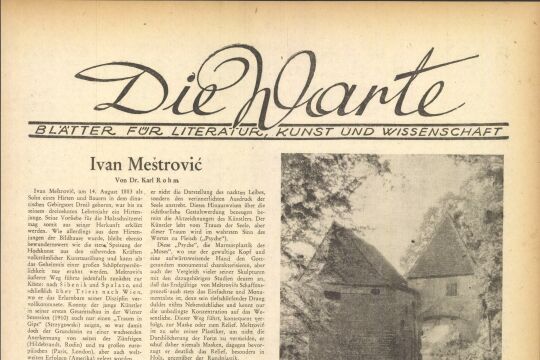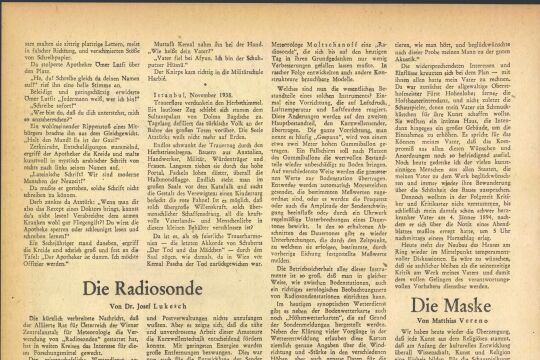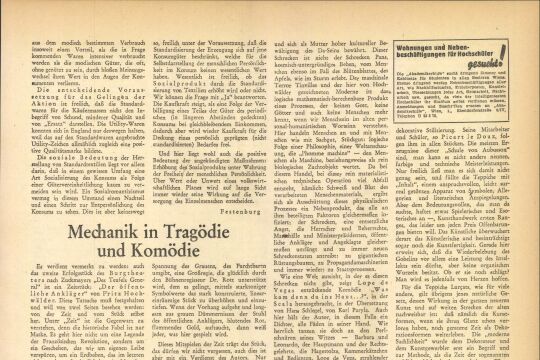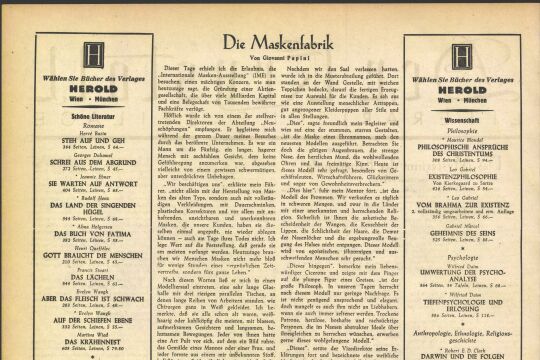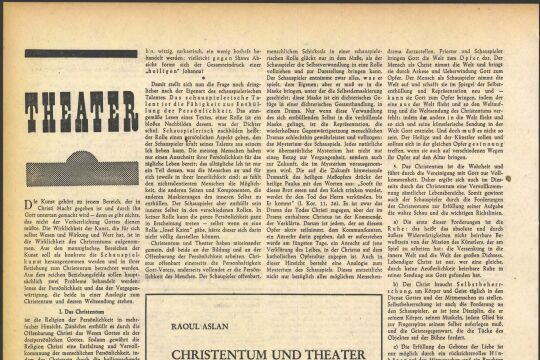Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Zauber des Verwandeins: Masken auf der Bühne
Wenn ein Schauspieler „Maske macht", legt er sein privates Äußeres ab und verleiht seinem Gesicht die charakteristischen Züge der Bühnenfigur, die er darstellt. Im Theater von heute bedient man sich dabei zumeist möglichst sparsamer Mittel. Das Gesicht soll auch die leisesten Gefühlsregungen unverhüllt spiegeln.
Dabei ist die Macht eines guten Maskenbildners über die menschliche Physiognomie beinahe unbegrenzt. Er kann ein junges Gesicht mit Altersrunzeln durchfurchen, mit Spezialplastiken die Form völlig verändern, Zahnlücken und Kahlköpfigkeit vortäuschen, ein Menschenantlitz in eine Fratze oder einen Totenschädel verwandeln.
Im Theater unserer Zeit gibt es aber auch Tendenzen, den theatralischen Akt durch den bewußten Einsatz von als Kunstgebilde erkennbaren Masken bewußt zu machen. So manch experimentelle Gruppe bedient sich dieser ästhetischen Möglichkeit: sei es in groteskfantastischer Betonung des Komödiantischen, sei es, um an das ursprünglich rituelle Ereignis der
Verwandlung im (theatralen) Spiel zu erinnern.
Die kenntlich gemachte Maske findet man aber nicht nur in der Off-Szene. Mit der Maske läßt sich Verfremdung besonders effektvoll erzielen. Katharina Thalbach hat es in ihrer als Festwochengastspiel auch in Wien gezeigten Inszenierung von Bert Brechts „Mann ist Mann" in radikaler Konsequenz bewiesen: die Maske umhüllte den ganzen Körper, unförmig ausgepolsterten Leibern waren Gummiköpfe aufgestülpt, Menschen zu lebendig gewordenen Comic-Figuren deformiert.
Mehr Rätsel gibt die Maske im Bildertheater, wie es zum Beispiel Achim Freyer gestaltet, dem Zuschauer auf. Menschengesichter können da zu beängstigenden Schminkkunstwerken erstarren oder hinter kunstvoller Verlarvung Visionen fremdartiger Wesen suggerieren.
Archaisches Pathos durch den Rückgriff auf manieristisch antikisierende Stilmittel brachte hingegen Jürgen Gösch in seiner Kölner Inszenierung des „König Ödipus" von Sophokles (1984) zum Ausdruck. Die auf hohen Kothurnen da-herstelzenden Darsteller trugen ihr
Leid hinter überdimensionierten, unbewegt von versteinertem Schmerz kündenden Masken zur Schau.
Das Theater der griechischen Antike kannte kein individuelles Mie-nenspiel/Die Komödien- und Tragödiendarsteller-durchwegs Männer - verbargen ihre Gesichter hinter Masken, die ihnen im wechselvollen Handlungsverlauf ein gleichbleibendes groteskes oder leidvolles Aussehen verliehen. Die Maske manifestierte die unauflösliche Bindimg des Theaters an den Dionysos-Kult, aus dem das abendländische Theater hervorgegangen ist.
Hatte einst ein Masken-Idol diesen Gott, dessen Verehrung in ekstatischem Rausch gleichfalls die Maske als Teilhabe und Selbstentäußerung verlangte, in magischer Präsenz erscheinen lassen, so bedeutete die Maske auch in ihrer ästhetischen Säkularisierung im theatralischen Spiel sowohl Verhüllung der eigenen Identität als auch das Kenntlichwerden als Verwandelter. Zwar durften nie mehr als drei Schauspieler auftreten, doch sie konnten im Handlungsverlauf mehin religiös kultische Bezüge eingebunden blieb, waren im alten Rom alle Arten szenischer Spektakel kommerzielle, auf merkantilen oder (tages)politisch nutzbaren Gewinn ausgerichtete Unternehmungen. Demgemäß war auch die Maske kein zwingend vorgeschriebenes kultisches Relikt, sondern ein beliebig einsetzbares Utensil. Man konnte sie gebrauchen oder ohne sie auskommen.
Im neuzeitlichen Berufskomö-diantentum kannte man zwar keine einen vorgeformten Ausdruck zur Schau tragenden Gesichtsmasken, aber im virtuosen Stegreifspiel der Commedia dell'arte verdeckten neutrale Halbmasken aus weichem Leder die Gesichtszüge der durch Kostümkonventionen sofort erkennbaren komischen Typen, deren Körpersprache mitteilte, was die Mimik verschweigen mußte. Der gewitzte Arlecchino mit vorgebundener Maske und im Flickenkleid darf - in all seinen Mutationen - bis heute ungestraft unbequeme Wahrheiten aussprechen. Hinter der schützenden Maske enthüllt sich schonungslose Offenheit. Das Theater lehrt den Umgang mit Alltags-masken.
Die Autorin ist Professorin für Theaterwissenschaft an der Universität Wien.
rere Rollen übernehmen und dank der nach Geschlecht und sozialem Stand typisierten Maske voneinander differenziert werden. Mit rhetorischer Kunstfertigkeit faßten sie die mimisch nicht darstellbaren Emotionen in Worte. Die Vermutung, die Mundöffnung der Masken hätte im Dreiviertelrund der Zig-tausende fassenden antiken Freilichttheater als Schalltrichter fungiert, wurde jedoch längst widerlegt.
Daß die antiken Maskenbildner in nachklassischer Zeit zunehmend realitätsnäher gestalteten, läßt sich der ältere Quellen resümierenden Zusammenstellung des Pollux aus dem zweiten Jahrhundeft entnehmen. Er nennt insgesamt 76 Maskentypen: 28 tragische, 44 komische, 14 satyrhafte; darunter auch „ambivalente" mit im Ausdruck divergierenden Gesichtshälften. Die zuordnenden Beschreibungen verweisen deutlich auf den Einfluß der Physiognomiker, die aus der physischen Beschaffenheit eines Menschen sein Temperament und seinen Charakter abzuleiten meinten und derart langnachwirkende Stereotypen in die Welt setzten.
Während das griechisch'-antike Theater zumindest äußerlich stets
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!