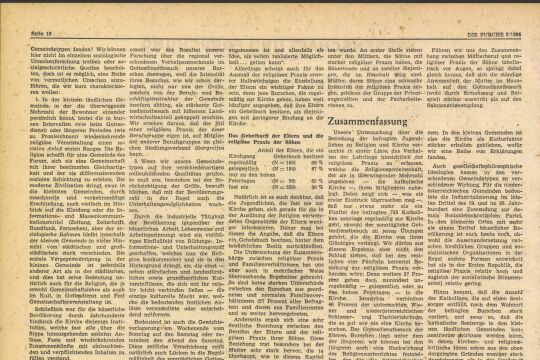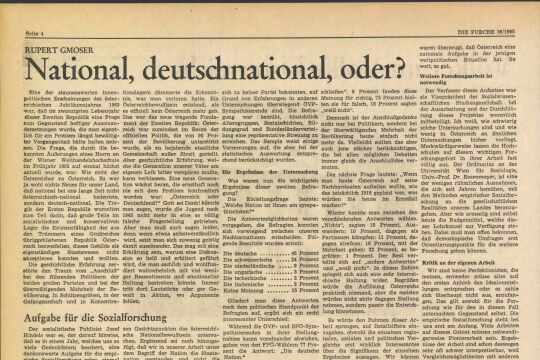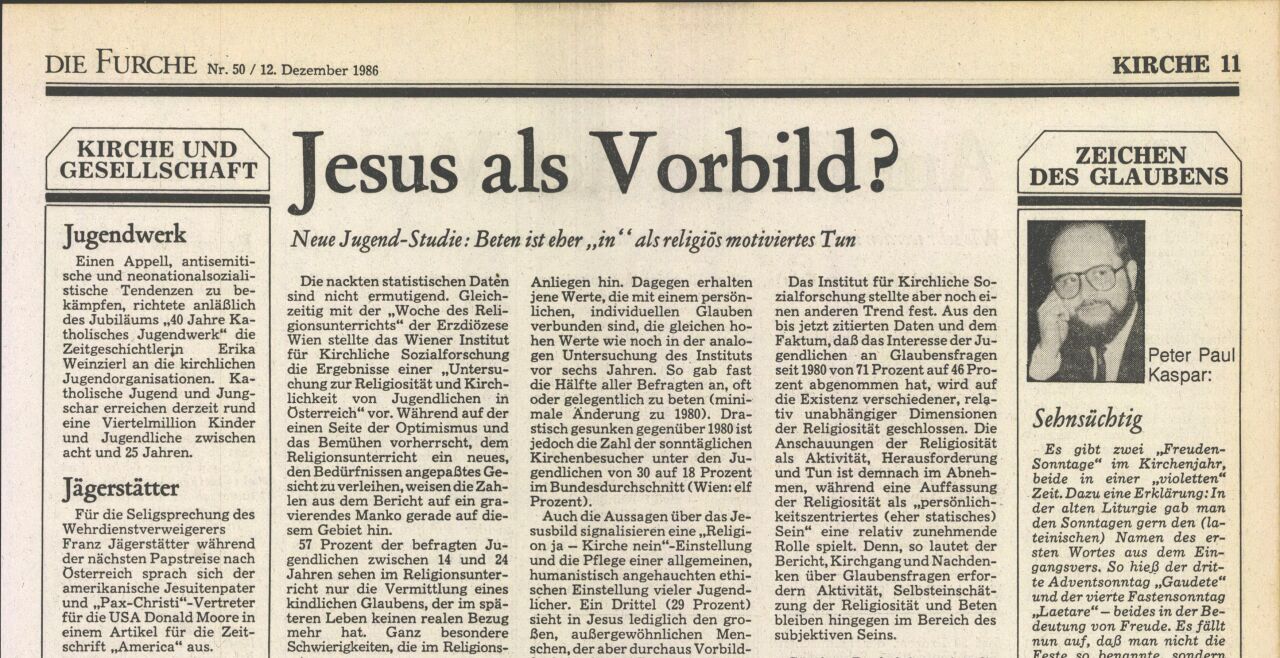
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Jesus als Vorbild ?
Die nackten statistischen Daten sind nicht ermutigend. Gleichzeitig mit der „Woche des Religionsunterrichts“ der Erzdiözese Wien stellte das Wiener Institut für Kirchliche Sozialforschung die Ergebnisse einer „Untersuchung zur Religiosität und Kirchlichkeit von Jugendlichen in Österreich“ vor. Während auf der einen Seite der Optimismus und das Bemühen vorherrscht, dem Religionsunterricht ein neues, den Bedürfnissen angepaßtes Gesicht zu verleihen, weisen die Zahlen aus dem Bericht auf ein gravierendes Manko gerade auf diesem Gebiet hin.
57 Prozent der befragten Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren sehen im Religionsunterricht nur die Vermittlung eines kindlichen Glaubens, der im späteren Leben keinen realen Bezug mehr hat. Ganz besondere Schwierigkeiten, die im Religions-
Unterricht vermittelten Inhalte als Glaubensbasis ins Erwachsenenalter mitzunehmen, haben jene Jugendlichen, denen entsprechende Verstärker aus Familie oder Bekanntenkreis fehlen.
Diese Tatsache deckt sich auch mit den Beobachtungen des Sekretärs der Katholischen Jugend Wien, Günther Danhel: „Es gibt dort Schwierigkeiten, wo der Religionsunterricht als einziger religiöse Werte vermittelt und der Hintergrund fehlt.“ Darin sieht er einen Grund für das schlechte Image des Religionsunterrichts. Den anderen sucht er zum Teil in den Unterrichtsmethoden. Religion werde in der modernen Pädagogik zu wenig fordernd präsentiert, die Schüler seien unterfordert.
Damit stellt er sich ein wenig in Widerspruch zu jenen, die die Anpassung des Unterrichts nach dem Motto „den Schüler dort abholen, wo er steht“ fordern: „Falsch verstandene Toleranz führt zur Nivellierung der Lebenshaltungen. Der Schwerpunkt sollte auf den Unterschied zwischen dem Erlösungsgedanken der Kirche und allgemeinem Humanismus gelegt werden.“
Die Ergebnisse der Untersuchung (die Befragung lief vom 3. bis zum 29. Jänner 1986, Stichprobe 1000 Personen) deuten aber auch in ihrer Gesamtheit auf ein wachsendes Mißtrauen der Jugendlichen gegenüber dem, was die Institution Kirche präsentiert, und auf ein abnehmendes Verständnis für ihre tatsächlichen
Anliegen hin. Dagegen erhalten jene Werte, die mit einem persönlichen, individuellen Glauben verbunden sind, die gleichen hohen Werte wie noch in der analogen Untersuchung des Instituts vor sechs Jahren. So gab fast die Hälfte aller Befragten an, oft oder gelegentlich zu beten (minimale Änderung zu 1980). Drastisch gesunken gegenüber 1980 ist jedoch die Zahl der sonntäglichen Kirchenbesucher unter den Jugendlichen von 30 auf 18 Prozent im Bundesdurchschnitt (Wien: elf Prozent).
Auch die Aussagen über das Jesusbild signalisieren eine „Religion ja - Kirche nein“-Einstellung und die Pflege einer allgemeinen, humanistisch angehauchten ethischen Einstellung vieler Jugendlicher. Ein Drittel (29 Prozent) sieht in Jesus lediglich den großen, außergewöhnlichen Menschen, der aber durchaus Vorbildfunktion hat. 44 Prozent stimmen der „orthodoxen“ Auffassung der katholischen und evangelischen Kirche zu, wonach Jesus als Sohn Gottes den Tod überwunden hat.
Ungefähr ein Drittel bezeichnet sich selbst als religiös, während sich jeder vierte Jugendliche als nicht religiös einschätzt. Dieser subjektiven Selbsteinschätzung, die sich in den letzten sechs Jahren nicht verändert hat, steht das Bild der offiziellen Kirche gegenüber, von der 59 Prozent der Befragten meinen, daß sie vor allem dazu da ist, Kinder zu taufen. Trauungen durchzuführen und Begräbnisse abzuhalten.
Das Institut für Kirchliche Sozialforschung stellte aber noch einen anderen Trend fest. Aus den bis jetzt zitierten Daten und dem Faktum, daß das Interesse der Jugendlichen an Glaubensfragen seit 1980 von 71 Prozent auf 46 Prozent abgenommen hat, wird auf die Existenz verschiedener, relativ unabhängiger Dimensionen der Religiosität geschlossen. Die Anschauungen der Religiosität als Aktivität, Herausforderung und Tun ist demnach im Abnehmen, während eine Auffassung der Religiosität als „persönlich-keitszentriertes (eher statisches) Sein“ eine relativ zunehmende Rolle spielt. Denn, so lautet der Bericht, Kirchgang und Nachdenken über Glaubensfragen erfordern Aktivität, Selbsteinschätzung der Religiosität und Beten bleiben hingegen im Bereich des subjektiven Seins.
Günther Danhel bestätigt die Grundaussagen des Berichtes. „Es herrscht“, meint er, „eine Gegenbewegung zum kritischen Christentum, die eher von Emo-tionalität geprägt ist.“ Doch der hohe Anteil an diffuser Religiosität entspreche dem öffentlichen Verhalten. Uberhaupt sieht Danhel für viele kirchliche Probleme Entsprechungen im allgemeinen Leben. Das Image der Kirche als Selbstbedienungsladen sei in dem Sinn auch staatlich geprägt. Das „Die-da-oben-werdens-schon-für-mich-richten“-Verhalten des „Sozialstaatlers“ ist in der Gesellschaft zu fest verankert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!