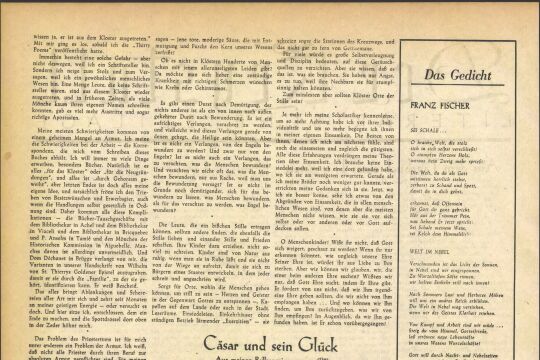Der Genosse Reiseleiter auf dem Flughafen von Tirana sprach es offen aus: „Unerwünscht sind Kontakte mit der Bevölkerung, unerwünscht sind lange Haare, weite Hosen, Maxiröcke, verboten ist das Photographieren öffentlicher Gebäude, des Hafens von Dürres, jedweder militärischer Personen oder Einrichtungen, das Verlassen des Hotels ohne Begleitung, die Benützung öffentlicher, nicht exklusiv dem Touristen vorbehaltener Verkehrsmittel wie Eisenbahn und Taxi...“ Nur wenige der eben aus Wien eingeflogenen Touristen schüttelten den Kopf, die Mehrzahl applaudierte. Waren sie doch — die meisten nicht zum ersten Mal — hierhergekommen, um sich von den Skipetaren eine Lektion in Sachen puristischer Marxismus-Leninismus zu holen. „Wenn es doch in der Bundesrepublik auch einmal so wäre wie hier“, erklärte ein bleicher, bebrillter Berliner allen Ernstes und sah sich dabei beifallheischend im Kreis seiner ultralinken Genossen um. Das Echo in Form von kollektivem Kopfnicken ließ nicht lange auf sich warten.
Es wäre zu einfach, diese Ansichten als eine Art von vorübergehender Geistesgestörtheit abzutun, gehörten nicht zur überwiegenden Mehrheit der nach Tirana angereisten Gruppen aus Frankfurt, Hamburg und Berlin Lehrer, Studienreferendare und angehende Beamte. Manch einer der privat eingereisten Deutschen begann in der Folgezeit Verständnis für den „Radikalenerlaß“ der Bonner Regierung zu entwickeln ...
Nach stundenlangem Warten auf Pässe, endloser Kontrolle des Gepäcks und dem umständlichen Ausfüllen von Zoll- und Devisenformularen — seltsamerweise in albanischer und russischer Sprache gedruckt — durfte man den Bus besteigen, der die buntgemischte Gesellschaft zum eigentlichen Reiseziel, dem Badeort Dürres an der adriati-schen Küste, führte. Während der Fahrt wiederholte der „Genosse Reiseleiter“, später unschwer als
stes zu identifizieren, noch einmal alle Verbote und Gebote, fügte aber in jovialem Ton an „die lieben Freunde“ hinzu, „ein Besuch des einzigen wahrhaft sozialistischen und atheistischen Landes der Welt“ sei eben ein unwiederholbares „Kollektiverlebnis“.
Im Hotelkomplex trennte man dann die Spreu vom Weizen, die Genossen und Freunde von den offensichtlich Ungläubigen. Ehrlich gesagt, bestand wohl beiderseits kein besonderes Bedürfnis nach engeren Kontakten. Während der folgenden Tage genossen die Nur-Urlauber den feinen Sandstrand, den köstlichen Sanderbeg-Cognac und die Friedhofsruhe des Hotelker-
kers. Enver Hodschas Epigonen hingegen versammelten sich täglich im Schatten der Palmen, um zu diskutieren und die auswendig gelernten Sprüchlein aus dem Repertoire von Marx, Engels, Lenin und Stalin (letzterer ist besonders gefragt) her-unterzubeten. Dabei hagelte es, zum Gaudium der Außenstehenden, Kritik und Selbstkritik in feinstem Parteichinesisch. Ungenügend vorbereitete Genossen schloß man gelegentlich vom weiteren Studium aus und verbot ihnen, an Ausflügen in das Landesinnere teilzunehmen. Wegen „Abweichung“, „bürgerlichen Benehmens“, aber auch wegen „Trunkenheit“ und „Verletzung der Parteidisziplin“. Als solche galt etwa der Flirtversuch mit einer der ohnedies nicht sehr attraktiven Genossi-nen.
Wie gefährlich es aber war, sich öffentlich über dieses seltsame Treiben lustig zu machen, zeigte am Ende der Reise der Fall des Friedrich K, eines pensionierten Beamten aus Frankfurt, der alljährlich nach Dürres kommt, weil das Klima seinem Asthmaleiden gut tut. K machte aus seiner CSU-Gesinnung kein Hehl und erklärte mehrmals zu fortgeschrittener Stunde in der rohgezimmerten Taverne des Hotels „Adriatic“, solchen „Maoisten und anderem Lumpengesindel“ gehöre mal anständig der Hosenboden versohlt und man solle diese Leute lieber gleich dabehalten, als ihnen die Gelegenheit zur Agitation in der Bundesrepublik zu geben. Unmittelbar vor seiner Abreise wurde K. vor eine Art von Volksgerichtshof gezerrt, dessen Auditorium aus den ultralinken Sympathisanten und den zwangsweise hinzugerufenen übrigen Touristen bestand. Als Ankläger fungierte der örtliche Albturist-Di-rektor, der wörtlich erklärte: „Herr K. ist ein Feind des albanischen Volkes, er hat unsere Gastfreundschaft mißbraucht, indem er sich als Schieber betätigte. Er hat nämlich Armbanduhren und Badehosen an Bürger von Dürres verkauft.“
Abgesehen davon, daß ein solches Geschäft wegen der totalen Abschirmung der Ausländer niemals hätte
zustande kommen können, entbehrte die Anschuldigung jeder Grundlage. Auf den Protest des verblüfften CSU-Mitgliedes hin, das sofort sein gesamtes Gepäck zur Untersuchung anbot, erhob sich einer der Gruppenführer aus Frankfurt und erklärte unter donnerndem Applaus seiner Genossen: „Was unsere albanischen Genossen sagen, ist die Wahrheit. Kommunisten lügen nicht.“ K. wurde klargemacht, daß man ihn wegen seiner „Verbrechen“ jederzeit in Albanien einsperren könnte, daß man diesmal aber noch Gnade vor Recht ergehen lasse, und daß er abreisen könne. Mit einem Visum für das nächste Jahr dürfe er
allerdings nicht rechnen. Vielleicht hatte K. einen entscheidenden Fehler damit begangen, daß er die jugendlichen deutschen Albanienfreunde „Maoisten“ nannte. Denn Mao, so scheint es, ist nicht mehr ganz „in“. China, so erklärten auch albanische Offizielle, sei weit und das Modell des dortigen Sozialismus auf europäische Verhältnisse nicht voll anwendbar. Beispielhaft hinge-
gen sei der Genosse Enver Hodscha mit seinen progressiven Lehren. Er hat Mao und Stalin aus den Schaufenstern der spärlich ausgestatteten Läden verdrängt, nur seine Werke in 20 Bänden gibt es — neben der Geschichte der KPA — in den Buchhandlungen zu kaufen. Und wegen des albanischen Vorbildes pilgern alljährlich rund zehntausend Mitglieder der „marxistisch-leninistischen“ Parteien aus ganz Westeuropa, aber auch aus Kanada und Australien, nach Tirana.
Hodscha und sein Team weigern sich nach wie vor, der von Peking ergangenen Empfehlung nachzukommen, das Land gegenüber Europa und den USA zu öffnen. Die jüngst erfolgten neuerlichen Säube-
rangen lassen erkennen, daß Widerspruch nicht geduldet wird. Die vor kurzem in Ungnade entlassenen Politbüromitglieder Kellezi, Teho-dosi und Piro Dodbiba (Landwirtschaftsminister) hatten die Höhe ihrer Karrieren während der Zeit des engsten albanisch-chinesischen Verhältnisses, in den späten sechziger und den frühen siebziger Jahren erreicht. Dodbiba, den Enver Hodscha schwerster Verfehlungen und Irrtümer bezichtigte, hat in seinem Ressort beachtliches geleistet. Zwar erreichten die landwirtschaftlichen Kombinate die Planziele für 1975 nicht, immerhin aber gab Planungschef Dode im Parteiorgan Zeri i Populit zu, dieses Jahr sei auf dem
Agrarsektor das erfolgreichste im ganzen Fünf jahresplan gewesen. Von der Trübung des albanisch-chinesischen Verhältnisses ist im Lande wenig zu bemerken. Pekings Abgesandte sind überall gegenwärtig. Sogar auf dem Flughafen von Tirana überwachen chinesische Sicherheitsbeamte jeden ankommenden oder abreisenden Passagier. Die Zahl dieser „Berater“ läßt sich schwer schätzen. Allein im Stahlkombinat von Elbasan, das mit dem Know-how und dem Geld Pekings errichtet wurde — und wegen dessen unfachmännischer Führung durch die Albaner die ersten Streitigkeiten entstanden —, sind mehr
als 1500 Söhne des Reiches der Mitte am Werk.
Höhergestellte chinesische Funktionäre sind auf den Straßen Albaniens schon von weitem erkennbar. Vor ihrem Mercedes-Benz fährt ein Militärjeep mit Rotlicht, dahinter mindestens ein Polizist auf dem Motorrad. In ähnlicher Weise lassen sich auch albanische Bonzen eskortieren.
Nördlich des Hotelkomplexes in Dürres befindet sich das Erholungszentrum der Partei-High-Society, mehr als hundert Villen inmitten gepflegter Gärten und Palmenhaine. Der gesamte Komplex ist mit Stacheldrahtzäunen umgeben, dahinter patrouillieren Milizstaffeln. Gelegentlich öffnet sich die Absperrung
und man kann dann vom Strand aus mit einem guten Fernglas beobachten, wie gutgekleidete Damen und Herren in westlichen Luxuslimousinen zwecks „Aufbau des einzig wahren sozialistischen Staates“ zu ihren Büros nach Tirana fahren. Privater Autobesitz ist in Albanien verboten. Auf meine diesbezügliche Anfrage, wem denn dann die vielen „guten Sterne“, aber auch Fiats und Skodas dienten, erwiderte der „Genosse Reiseleiter und Aufpasser“, hiebei handle es sich um Volkstaxis, die eigentlich allen gehörten, aber von den ZK-Mitgliedern benützt würden, damit diese effizientere und schnellere Kommunikation mit den Problemen des Landes erwerben
könnten. „Bedenken Sie, daß auch Enver Hodscha jede Woche einmal im Ernteeinsatz steht.“ Zugegebenermaßen ein guter Show-Effekt; aber nicht unbedingt neu.
Frappanter als diese naiven Indoktrinationsversuche wirkt auf den Albanienbesucher der doppelt symbolkräftige Skanderbeg-Kult. Besonders deutlich wird dieser bei einem Besuch des Adlernestes Kraja in Mittelalbanien. Hier verteidigte der Feudalherr Skanderbeg (wörtlich übersetzt: General Alexander) das Land 25 Jahre lang gegen eine osmanische Übermacht. Sein Schwert, das dreizehn Kilogramm wiegt und auf die enorme Körperkraft Skanderbegs schließen läßt, wird im Museum stolz gezeigt, desgleichen sein überdimensionales Kettenhemd.
Dieser Wallfahrtsort des skipetari-schen Nationalismus soll beweisen, daß auch ein kleines Land einem übermächtigen Gegner trotzen kann — was auch der heutigen Staatsphilosophie entspricht. Anderseits war Skanderbeg ein Feudalherr, der den Patriotismus über die Klassengegensätze stellte und Arme und Reiche, Handwerker und Bauern gegen die Türken vereinte. Auch Enver Hodscha und sein Kampfgefährte, der Premier Mehmet Shehu, stammen aus der Oberschicht des Landes.
Den letztlich doch siegreichen Türken verdankt Albanien eine Reihe von prächtigen Moscheen und die Tatsache, daß die Mehrzahl seiner Einwohner, vor allem im Süden, muslimischen Glaubens ist — oder besser gesagt: war. Denn seit sich Albanien 1967 „von allem religiösen Obskurantismus“ befreit hat und den ersten atheistischen Staat der Welt proklamierte, sind die mehr als 2000 Gotteshäuser des Landes geschlossen oder zu Kinos und Bierlokalen umfunktioniert worden. Die Einfuhr religiösen Schrifttums aller Art ist streng untersagt.
Per Dekret vom 1. März dieses Jahres sind die albanischen Staatsbürger außerdem verpflichtet, politisch, ideologisch und moralisch verwerfliche Vor- und Zunamen zu ändern. Bis zum 31. Dezember dieses Jahres soll die Aktion abgeschlossen sein. Ob sie auch Herrn Hodscha (der türkische Name bedeutet auf deutsch „Priester“) oder den nach den Kalifen Mehmed benannten Premier Shehu erfassen w'ird?
Man verläßt Albanien mit dem Gefühl, in einer anderen Welt, auf einem fremden Planeten gewesen zu sein. Es ist ein Land, das viel von Orwells „1984“ vorweggenommen hat, gleichzeitig aber eine Unzahl von Rätseln im Hinblick auf seine zukünftige Entwicklung aufgibt. Werden die Albaner — wie einst Skanderbeg — noch jahrzehntelang allen Einflüssen von außen Stand halten können?
Pläne für ein Albanien der Ära nach Enver Hodscha liegen zweifellos schon jetzt in den Schubladen der Politplaner in Washington, Moskau, Belgrad und — wie anzunehmen ist — auch in Peking.