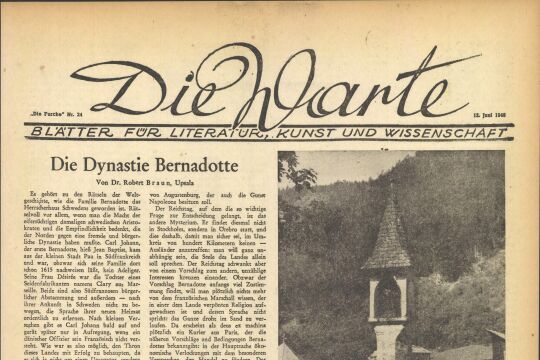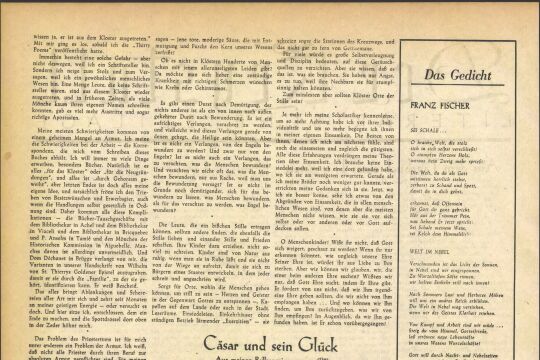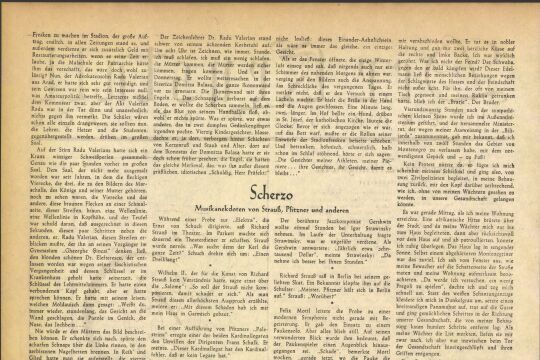Es wäre übertrieben, zu behaupten, daß der h. u. k. Botschafter Markgraf Johann Palla-vicini mich'mit besonderer Begeisterung empfing, als ich im Herbst 1917, als Vertreter der „Reichspost“ aus Sofia zu einem längeren Aufenthalt in die Türkei kommend, mich wie üblich beim Botschafter Oesterreich-Ungarns meldete.
„Eigentlich habe ich immer ein unangenehmes Gefühl, wenn sich ein Journalist aus der Monarchie in diesen unruhigen Zeiten bei mir vorstellt“, meinte der ältere, sehr würdige Aristokrat, als ich, seine ablehnende Haltung bemerkend, mich etwas verlegen zeigte.
„Sie müssen, um mich zu begreifen, wissen, wie heikel der Boden jetzt in Konstantinopel ist und wie vorsichtig man die Türken anfassen muß. Meine Warnung ist allgemeiner Natur, und Sie dürfen sie nicht als gegen Sie gerichtet auffassen. Ich bitte Sie nur, äußerst vorsichtig zu sein, sonst ist leicht ein Malheur geschehen. Einer Ihrer Kollegen aus Oesterreich, allerdings Vertreter einer Berliner Zeitung, mußte am eigenen Leibe erfahren, wie schwankend der Boden der Türkei ist.“
Der Botschafter, den ich im Laufe meiner späteren Tätigkeit in der Türkei nicht nur als äußerst klugen und versierten Diplomaten, sondern auch als gütigen, warmherzigen Mann von gutem Willen jedermann gegenüber erkennen sollte, erzählte mir als Trost für die etwas kühle Einleitung jenen Vorfall, der ihn Journalisten gegenüber so voreingenommen gemacht hatte. Der unrühmliche Held des Dramas war der bekannte Berichterstatter des „Berliner Tageblattes“, Dr. Leo Lederer, der sich den Unwillen Enver Paschas, des Vizegeneralissimus der türkischen Armee, zugezogen und als österreichischer Staatsbürger, da matt ihn rechtzeitig vor seiner drohenden Verhaftung gewarnt hätte, in der k. u. k. Botschaft Schutz gesucht und auch gefunden hatte. ; '
Dr. Lederer wurde vom „Berliner Tageblatt“ nach Konstantinöpel entsendet, um dia Führer des jungtürkischen Komitees zu interviewen und über die Lage in der Türkei zu berichten. Sein erster Weg führte ihn in das Seraskeriat (Kriegsministerium), wo er sich bei der • Adjutantur Enver Paschas meldete und um eine Unterredung mit Seiner Hoheit bat. (Enver war nicht nur Vizegeneralissimus der türkischen Armee, sondern auch Schwiegersohn des Sultans, als dem ihm der Titel Hoheit gebührte.) Der Adjutant Oberstleutnant Scheffki Bei nahm den Wunsch entgegen und bestellte Dr. Lederer auf den nächsten Tag. Die Bemerkung des Journalisten, daß er wenig Zeit habe, da er nur wehige Tage in der Türkei zu bleiben gedenke, hatte Scheffki Bei überhört, denn im Orient gilt jemand, der es eilig hat, als ungezogen. Man darf es nie eilig haben, und besonders nicht, wenn man es mit einer so hohen Person zu tun hat wie Seiner Hoheit. Am nächsten Tag nun sprach Dr. Lederer wieder vor und bekam zu hören, daß Seine Hoheit stark beschäftigt sei und er morgen wiederkommen möge. So ging das weitere drei Tage. Nun hat das türkische Wort „morgen“ (jarim) eine sehr zwiespältige Bedeutung. Es kann w i r k 1 i ch „morgen“ heißen, es kann aber auch bedeuten „nie“. Mit dieser Eigentümlichkeit des türkischen Sprachgebraudies war aber Dr. Lederer, obzwar er schon eine längere Balkanpraxis hinter sich hatte, nicht vertraut. Endlich ver-, .stand Dr. Lederer aber doch, daß dieses ständige Vertrösten auf „morgen“ nur eine höfliche Form der Ablehnung in der blumenreichen Sprache des Orients war, und richtete etwas unwirsch die Frage an Scheffki Bei, ob vielleicht Seine Hoheit ihn zu empfangen ablehne? Worauf er auf die gerade Frage die gerade Antwort erhielt:
„Seine Hoheit hat für Journalisten kein Interesse und gibt keine Interviews, die übrigens mit seinem hohen Rang unvereinbar sind.“
Nun wußte er endlich, woran er war, und fuhr aus dem Seraskeriat geradewegs nach dem Telegraphenamt, um folgende Depesche an seine Berliner Redaktion zu senden:
„Enver Pascha erklärt, kein Interesse an Journalisten-zu haben, und lehnt es ab, Ihren Vertreter zu empfangen. Bitte demzufolge vom, heutigen Tage ab von der Existenz Enver Paschas im .Berliner Tageblatt' keine Kenntnis nehmen zu wollen.“
Natürlich ging diese Kriegserklärung. an Enver von der Zensur ins Kriegsministerium und wurde Enver, einem Herrn mit stark entwickeltem Selbstbewußtsein, brühwarm vorgelegt. Das hatte zur Folge, daß das Poli-zeihauptquartier für Pera, Galata Serail,
Befehl erhielt, Dr. Lederer im Hotel „Pera Palace“ sofort zu verhaften. Nun saßen damals, wie nicht anders zu erwarten, überall Agenten und Vertrauensleute Deutschlands, und noch bevor der Haftbefehl hinausging, wußten davon sowohl die deutsche Botschaft wie der deutsche Militärbevollmächtigte General Lossow. Der deutsche Botschafter weigerte sich jedoch, Dr. Lederer bei sich aufzunehmen, da Lederer Oesterreicher war, und so kam Dr. Lederer in die österreichisch-ungarische Botschaft als Sorgenkind zum Markgrafen Pallavicini.
Der immer hilfsbereite Botschafter ließ den Journalisten in ein Gastzimmer der Botschaft einquartieren und fuhr sofort, bei der Hohen Pforte Aufhebung des Haftbefehls und sicheres Geleite für den „Uebeltäter“ zu erwirken. Alles umsonst! Enver, die personifizierte Eitelkeit, wollte für diese beispiellose Majestätsbeleidigung seine Rache haben. Die Noten flogen hin und her, und nach acht Tagen Zwangsaufehthalt in der Botschaft schmuggelte man Dr. Lederer in der Uniform eines k. u. k. Soldaten aus der Botschaft zur Bahn nach Sirkedjie und verstaute ihn in einem Militärtransport. . .
Was für Aufregungen diese Vorgänge dem Botsdiafter, der die Korrektheit selber war, bereitet hatten, kann nur der ermessen, der diesen gewissenhaften, warmherzigen und geradlinigen Mann gekannt hat. Er war auf solche Kintoppeffekte, wie Flucht aus seiner Botschaft in Verkleidung, wirklich nicht eingerichtet gewesen.
Dr. Lederer entkam so der Rache Envers, aber alle Journalisten, die nach ihm nach Konstantinöpel kamen, hatten die Folgen des Abenteuers sowohl bei den Türken wie in den Botschaften Oesterreichs und Deutschlands'zu tragen.
Im Jahre 1917, gegen Ende des Winters, trat die große Wende für die türkische Kriegführung ein. Seit dem Frieden von Kutsuk Kainardjie im Jahre 1774 war die Türkei in Asien, Afrika und Europa immer mehr und mehr zurückgewichen. In den zweihundert Jahren bis zum ersten Weltkrieg waren Kriege für die Türkei stets gleichbedeutend mit Gebietsverlust, und selbst ein so siegreicher Blitzfeldzug wie der Edhem Paschas gegen die Griechen im Jahre 1897 brachte statt Gewinn nur weitere Einbußen. Im Frühjahr 1918 zerbröckelte die russische Armee so wie anderswo auch an der Kaukasusfront, und die Türken unter dem Oberbefehl Wehib Pasdias nahmen nicht nur die besetzten türkischen Gebiete zurück, sondern verfolgten die russischen Armeereste weit über die Grenze. Diese Erfolge mußten doch propagandistisch ausgewertet werden und sollten die früheren strategisch-taktischen Scharlatanerien Envers vergessen machen. So sah sich Enver Pascha veranlaßt, doch die_Dienste der Presse in Anspruch zu nehmen, und lud zu der bevorstehenden Siegesfahrt nach Batum den beinahe allmächtigen Vertreter der „Frankfurter Zeitung“, Paul Weitz, und mich, den Vertreter der „Reichspost“, dessen Türkenfreundlichkeit in der Hauptstadt bekannt war, in aller Form ein.
Der schönste Dampfer der türkischen Flotte, die Luxusjacht „Gül Dsemal“, wurde zu der Fahrt in größter Eile hergerichtet. Und in den ersten Apriltagen fuhren wir nach Batum ab.
Batum wurde damals schon von keinem Menschen verteidigt. Von russischen Truppen und Kriegsschiffen vollkommen verlassen, lag diese einst wichtige Seefestung des Schwarzen Meeres da, sehnsüchtig darauf wartend, daß die in der Umgebung massierten türkischen Truppen endlich von der Stadt Besitz ergreifen und der Unsicherheit ein Ende bereiten würden. Aber das Einrücken der türkischen Truppen wurde auf Befehl aus Konstantinopel immer wieder hinausgeschoben, weil das türkische Oberkommando unur Enver Pascha bei dem' siegreichen Einzug dabei sein wollte.
Eine Fahrt im Schwarzen Meer im Frühjahr 1918 war keine sonderliche Annehmlichkeit, sondern trotz des russischen Zusammenbruches ein gefährliches Unternehmen. Zwischen der Türkei und Rußland herrschte noch Kriegszustand, und die russische Flotte war, da die zwei besten Einheiten der türkischen Kriegsmarine, „Sultan Jawus“ und „Midilli“ (die früheren deutschen Kriegsschiffe „Goe-ben“ und „Breslau“), infolge schwerer Havarien damals ausgeschieden waren, der türkischen Kriegsmarine weit überlegen. Sie beherrschte, ohne auf Gegner zu stoßen, das Schwarze Meer. War es nun, weil der Spionagedienst im neuen Rußland noch nicht richtig funktionierte oder weil die bolschewisierte Flotte gerade keine Lust zur Betätigung hatte, kurz, die Fahrt der „Gül Dsemal“ verlief ohne Zwischenfall.
Eine gute Prise wäre aber dieser Luxusdampfer doch gewesen, und wenn die Sowjets einen Funken Humor gehabt hätten, hätten sie die gute Gelegenheit nicht versäumt, den Festteilnehmern eine kleine Ueberraschung zu bereiten. Auf der „Gül Dsemal“ war nämlich sozusagen das ganze türkische Oberkommando versammelt: Enver Pascha, der Thronfolger Oemer Farruch, ein blutjunger, liebenswürdiger Prinz aus dem Hause Osman. (Diesem Prinzen begegnete ich 18 Jahre später bei einem Essen an der französischen Riviera, und wir tauschten Erinnerungen aus der Jugendzeit aus. Unvergessen bleibt mir, daß er voraussagte, die von Kemal Atatürk betriebene religionsfeindliche Politik werde bald nach dem Tode des Diktators einer religiösen Renaissance Platz machen. — „Allah ist nicht gestorben. Er ruht nur. Man wird in nicht ferner Zeit die Stimmen des Muezzins wieder hören, der der Welt wie einst verkünden wird: Allah il Allah“, sagte er mir, dem skeptisch Zuhörenden, damals. Und er hatte recht behalten.) An Bord waren ferner der Chef des türkischen Generalstabes, Generaloberst von Seeckt; der Chef der taktischen Abteilung, Oberst v. Friedmann, und andere Generale von der Mission Liman von Sanders. Dazu kamen noch hohe türkische Offiziere aus der Suite Enver Paschas, der gerne mit königlichen Ehren auftrat.
Konstantinopel im Frühjahr 1918 den Rücken zu kehren, war, auch wenn man diese Märchenstadt noch so liebte, doch ein wahres Vergnügen. Der Flecktyphus wütete und forderte täglich hunderte Opfer. Niemand war vor dieser Seuche sicher. Selbst die Gattin des deutschen Botschafters von Kühlmann fiel der tückischen Krankheit zum Opfer. Zudem herrschte in der Stadt bitterste Hungersnot. Das ausgepowerte Volk der Millionenstadt starb in Massen und in aller Oeffentlichkeit. Auf den Straßen, Plätzen und Friedhöfen lagen Tote und Sterbende. Sie wurden während des Tages auf Karren geworfen und bestattet. Es war die leibhaftige Hölle.
Auf der „Gül Dsemal“ waren wir königlich bewirtet. Da war vom Elend wirklich nichts zu merken, und man hatte richtig Gewissensbisse, wenn die Stewards zu den Mahlzeiten mit allen Genüssen der orientalischen und europäischen Küche in nicht endenwollender Speisenfolge aufwarteten. Nur Alkohol wurde vermißt, besonders von den deutschen Herren ... Aber Enver Pascha, der „preußische Premierleutnant“, wie ihn nichtgewogene Kreise spöttisch nannten, war gläubiger Mohammedaner und hielt streng die Befehle des Propheten. So mußte man sich, um Alkohol zu bekommen, in die Kabine entweder der deutschen Herren oder des Reisemarschalls H... Bei einladen lassen, der, wenn er auch selbst nicht trank, doch Verständnis für seine Gäste hatte.
Der Sicherheit halber fuhr unser Dampfer in den ersten Tagen in Reichweite der Küste, um bei Gefahr sofort die Fahrgäste in den reichlich vorhandenen Rettungsbooten an Land bringen zu können. Aber die Russen schliefen zu unserem Glück. Und ani dritten Tage der Fahrt wiegten wir uns schon so weit in Sicherheit, daß wir uns auf die höhe See wagten. Wir hatten wunderbar mildes Frühlingswetter, und unzählige Delphine spielten in den vom Sonnenschein erwärmten Fluten. Da erwachte in Enver Pascha die Jagdlust. Er veranstaltete — mit türkischen Armeekarabinern! — eine große Delphinjagd. Enver Pascha war ein Meisterschütze, und man sagte, daß mit Ausnahme des damals schon toten, abgesetzten Sultans Abdul Hamid II. keiner es zu solcher Meisterschaft als Pistolen- und Karabinerschütze gebracht habe. So saß auch jeder Schuß Envers, den er auf die fröhlich wie Kinder spielenden Delphine abgab, zum großen Mißbehagen der düster dreinschauenden Seeleute. Denn in der ganzen Welt verehren Seeleute die Lebensretter des Propheten Jonas und glauben fest daran, daß sich jeder Frevel gegen diese harmlosen Tiere bitter rächt. Wie stark dieses Schlachten der Delphine auf die Besatzung der „Gül Dsemal“ gewirkt hat, erkannte ich erst nach Jahren, als ich, lange nachdem Enver Pascha unter den Schwerthieben der Sowjetreiterei in Turkestan den Tod gefunden hatte, in Konstantinopel einem Kapitän der „Gül Dsemal“ begegnete und dessen erstes Wort nach der Begrüßung war:
„Sehen Sie, wie sich die Delphinschlächterei gerächt hat! Wo sind jetzt Enver und seine Offiziere?“
Am 13. April trafen wir in Trapezunt-Trebisonda ein und wurden vom Oberkommandierenden der Kaukasusarmee, Wehib Pascha, einem liebenswürdigen, Oesterreich sehr verehrenden Offizier von so riesenhaftem Umfang, daß er auf kein Pferd steigen konnte, freundlichst empfangen. Sodann wurde das Programm des Einmarsches nach Batum festgelegt. Der 14. April sollte der Tag des denkwürdigen Ereignisses sein, an dem der siegreiche Halbmond in einer dem Türkischen Reich wiedergewonnenen Stadt gehißt wurde. Dieses Ereignis peitschte die leicht entzündbare Phantasie Enver Paschas mächtig auf. Er sah vor seinen geistigen Augen die siegreichen Heere des Islams, die für die Erniedrigungen der letzten zweihundert Jahre Rache nehmen würden. Enver Pascha hatte zwar viele, sehr viele Fehler, er war überheblich und ruhmsüchtig, aber er war ein glühender Patriot und ein gläubiger Sohn seines Glaubens, der mit dem Elan seiner sprichwörtlichen Tapferkeit sein Leben ohne Bedenken in die Waagschale warf, wenn die Ehre und das Interesse seines Landes dies verlangten.
In gehobener Stimmung zogen wir dann am 14. April, einem goldigen Frühlingstag, mit der türkischen Armee in die See- und Landfestung Batum ein. An der Spitze des Heeres Enver Pascha, hoch zu Roß, mit seinem großen Stab in glänzenden Uniformen. Die Huldigung der Vertreter der Stadt nahm er mit der hochmütigen Miene eines römischen „Imperator triumphans“ entgegen.
Nach 24 Stunden Aufenthalt verließen wir Batum, und da ich in Trapezunt den Dampfer verlassen sollte, um von dort aus meine Expedition nach dem Bin-göl-Dagh und Mesopotamien anzutreten, zog mich Enver, kurz nachdem wir Batum verlassen hatten, in ein zweistündiges Gespräch. An den letzten Teil des Gespräches, der auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht hat, erinnere ich mich noch heute, nach 34 Jahren, genau.
„Sie verlassen uns sonach in Trebisonda? Schade! Ich sehe gerne bekannte Gesichter in meiner Nähe.“ (Bei einem Mann, der täglich mit einem Attentat zu rechnen hatte, kein Wunder.) Enver sprach das akzentfreie, etwas schnodderige Deutsch der Berliner Gardeoffiziere.
„Und wann glauben Sie wieder in Stambul zu sein?“
„Ich rechne damit, Hoheit, wenn alles gut geht, Ende August wieder zurück zu sein“, antwortete ich, und er nickte zustimmend.
„Das ist mir recht so, aber nicht später, denn ich wünsche, daß Sie den indischen Feldzug mit uns mitmachen. Anfang September geht die Sache los, und Sie müssen sich nach den Strapazen, die Sie jetzt mitmachen werden, gut ausruhen, denn es wird kein Spaziergang werden.“
Ich muß bei diesen Worten ein so ungläubiges Gesicht gemacht haben, daß Enver stehenblieb und bemerkte:
„Sie scheinen meine Worte nicht verstanden zu haben?“
Enver sagte das etwas ungeduldig, und ich beeilte mich, eingedenk der Worte unseres Botschafters, zu versichern, daß mir die freudige Erregung die Worte genommen habe. Wäre ich ein aufrichtiger Dolmetsch meinei Gedanken gewesen, so hätte ich ihm wohl gesagt, daß ich seine 'w'orte nur als Scherz auffassen kann. An allen Ecken und Enden fehlte es damals — und mit schlecht genährten und kaum bekleideten Soldaten will man die bestgenährten Armeen, denen die Hilfsquellen der ganzen Welt zur Verfügung stehen, auf tausende Kilometer von der eigenen schwachen Basis entfernt, angreifen? Das alles kam mir vor wie ein Fiebertraum. Doch war es keine Phantasie, sondern Wirklichkeit. Nüchtern betrachtet: die Wirklichkeit einer Irrenanstalt. Schon in Berlin hatte ich bald nach Ausbruch des Krieges ähnliche Gerüchte aufgefangen, das waren aber nur Gerüchte aus unverantwortlichen Kreisen. Die von Sachkenntnis unbeeinflußte Phantasie durfte sich ja an solcher Fata Morgana erfreuen. Das nützte und schadete niemand. Aber Enver Pascha war kein Unverantwortlicher. Hinter ihm stand eine zwar abgekämpfte, verhungerte, aber zu jedem Opfer bereite Armee, die im gegebener Fall, ohne zu murren, in blindem Gehorsam bis in den Tod marschierte. Ja, Enver war jeder militärische Unsinn zuzutrauen. Im Balkankrieg ersann er die geniale Operation, eine Reserverarmee im Golf von Ismid zu konzentrieren und dann mit Hilfe aller Transportmöglichkeiten im Rücken der bulgarischer Armee bei Rodosto zu landen. Diese Bedrohung mußte, so dachte er, die Bulgaren zum. Rückzug zwingen. Die ganze geniale Operation endete wie das Hornberger Schießen. Die Transportflotte wurde mit Artilleriefeuer empfangen und beeilte sich, dorthin zurückzu-segeln, von wo sie gekommen war. Inzwischen hätte man aber diese zwanzigtausend Bajo nette so gut bei Tsataldja brauchen können!
Auch die Mobilisierung von zwei Millionen Mann bei Eintritt der Türkei in den Weltkrieg war eine Fieberphantasie. Man hatti keine Ausrüstung, keine Nahrung, keine Ubi-kationen, keine Transportmittel für diese Riesenarmee, die in den öden Bergen des armenischen Hochlandes zu Hunderttauseriden verhungerte und erfror. Und jetzt zu guter Letzt soll der Hindukusch Zeuge sein der kopflosesten, leichtsinnigsten militärischen Operation, die die Kriegsgeschichte kennt?
Eskamnichtdazu. Die deutsche Frühjahrsoffensive war gescheitert, die Offensive der Entente im Sommer 1918 dagegen eir voller Erfolg. Nun dachte niemand mehr an Angriff. Der Zusammenbruch kam, Enver floh und tauchte ein Jahr später an der Spitze seiner Reiterscharen in Turkestan auf. Die Lockung eines panturanischen Kaisertums mit dem Thron eines Großmoguls in Agra oder Delhi führte ihn nach Turkestan und Fer-ghana, dem indischen Traum eines modernen Alexander des Großen entgegen.
Mit den Prunkgewändern eines Emirs bekleidet, fiel er gegen eine zehnfache Ueber-macht der Tscheka auf dem Schlachtfelde von Duschamba in Turkestan. Ein glänzender Reiteroffizier, der ideale Schwadronchef — aber alles andere, als ein Feldherr. Ein wahrhafi romantischer Held, würdig, von einem Fir-dusi besungen zu werden. Alle, die wir ihr näher kannten, liebten ihn trotz seiner Feh ler, diese leibhaftige Gestalt aus unserer Kin dermärchenzeit der Tausendundeinen Nacht. Diesen Streiter für seinen Glauben und sein Volk, der an dessen Zukunft unerschütterlicl glaubte, als alle anderen verzweifelten. Er starb, wie es zu seiner Märchengestalt paßte mit dem Schwert in der Rechten und den Koran in der Linken. So ließ er sich in Stücke hauen, als Vollendung eines phantastischen Lebens.