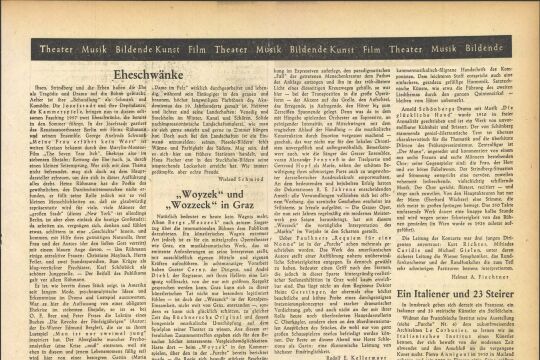Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mrawinskij und die Seinen
Im Großen Musikvereinssaal fanden am vergangenen Freitag und Sonntag zwei Konzerte statt, die nicht nur Anlaß zu Begeisterungskundgebungen waren, sondern über vielerlei nachzudenken anregten. Überdies bestätigten sie den vorzüglichen und nachhaltigen Eindruck, den wir vom ersten Wiener Konzert der Leningrader 1956 empfangen haben, als sie im gleichen Saal Mozart und Tschaikowsky spielten.
Im Großen Musikvereinssaal fanden am vergangenen Freitag und Sonntag zwei Konzerte statt, die nicht nur Anlaß zu Begeisterungskundgebungen waren, sondern über vielerlei nachzudenken anregten. Überdies bestätigten sie den vorzüglichen und nachhaltigen Eindruck, den wir vom ersten Wiener Konzert der Leningrader 1956 empfangen haben, als sie im gleichen Saal Mozart und Tschaikowsky spielten.
Was für ein Glück für ein Orchester und einen Dirigenten, rund 35 Jahre zusammenzuarbeiten! Gewiß, im Orchester wechseln die Musiker, vor allem die „Solisten”, doch entsteht so etwas wie eine Tradition, vergleichbar der unserer Philharmoniker, die sich — wie man es immer wieder in den Konzerten erlebt — unter verschiedenen Dirigenten aufs erfreulichste entfalten und unter den Händen ihrer Lieblinge aufblühen. — Bei den Russen ist es etwas anderes: Hier hat ein Mann, ohne daß man den Eindruck hat, daß er seinen Musikern „den Herrn zeigt”, ein Ensemble von Weltformat herangebildet, das seinem leisesten Wink mit manchmal fast mechanisch anmutender Präzision folgt. Mrawinskijs Leidenschaften werden zwar nicht „verdrängt”, aber unter strenger Kontrolle gehalten. „Spielfreude” wird, zumindest nach außen hin, nicht vordemonstriert. Hingegen sind Präzision und Schlagkraft kaum überbietbar, was bekanntlich echten Gefühlsausdruck und zarteste Emotionen nicht auszuschließen braucht.
Beginnen wir, wie das Programm, mit Prokofjew. Er brachte es, ähnlich wie sein Landsmann Tschaikowsky. auf 7 Symphonien, und in dieser seiner vorletzten, etwa 1945 begonnen und 1947 unter der Leitung Eugen Mrawinskijs in Leningrad ur- aufgeführt, zeigen sich alle imponie renden Qualitäten sowie auch einige weniger bedeutende Schwächen dieses zweifellos genialen Musikers. Prokofjews Tonsprache ist aus sehr heterogenen Elementen zusammengesetzt, deren er sich wohl bewußt war: Klassizismus, d. h. an alten Modellen orientiertes Formgefühl, Revolutionäres (oft zeit-, ja modebedingt), Motorik, die seiner Musik einen quasi „athletischen” Grundzug verleiht, wozu auch die häufig verwendeten tiefen Bässe, ähnlich wie bei Honegger, beitragen, und ein ganz spezieller Lyrismus, der aber nie unter impressionistischen Schleiern verdeckt erscheint, sondern mit einer gewissen Naivität sich darstellt. Prokofjews Schwächen sollen bei diesem Anlaß nicht breitgetreten werden. Wir wdllen aber nicht versäumen hervorzuheben, mit welch unnachahmlicher Eleganz Mrawinskij gewisse melodische Banalitäten verfeinert oder einfach über sie zur Tagesordnung übergeht — Nur an einer einzigen Stelle des dreisätzi- gen 36-Minuten-Werkes haben Mrawinskij und seine Blechbläser die Akustik des großen Musikvereinssaales ein wenig unterschätzt. Dafür aber gab es im Verlauf des ganzen Abends keinen einzigen Homgickser — fast ein Weltrekord!
Die „Feuerprobe” für die Gäste aus Leningrad war natürlich Beethovens „Fünfte”, und sie haben die se in hohen Ehren bestanden. Gleich von den ersten so überaus wichtigen Akkorden fiel der noble Klang des Orchesters sowie der tiefe, ehrfürchtige Ernst auf, mit dem Mrawinskij, brav aus der Partitur dirigierend, sich dem Meisterwerk nähert. Nach einem bestens gelungenen 1. Satz folgte das „Adante con moto”, dem man nicht ohne angenehmste Emotion zuhörte. Und bedenkt, liebe Wiener Musikfreunde, hier versuchten Leute von weither in Eurer Sprache zu Euch zu reden — und wem ginge das nicht zu Herzen! — Viele Einzelschönheiten wären in den beiden letzten Sätzen noch besonders hervorzuheben. Erinnern wir nur an das wunderbar abgestufte Decrescendo im 3. Satz und das unmittelbar nach diesem beginnende „jubelnde Finale”, das dann ins eigentliche Allegro-Finale übergeht. — Das einzige, was man kritisch anmerken könnte, war, daß man auf weite Strecken einen unsichtbaren Metronom mitticken hörte: so konsequent liebt Herr Mrawinskij die Tempi durchzuhalten. Und es fehlte am Schluß etwas von jenem vibrierenden Enthusiasmus, den einzig und allein Wilhelm Furtwängler gerade diesem schwierigsten Teil des Werkes zu verleihen wußte. Das lag vor allem an dem präzisen, oft ein wenig harten Schlag Mrawinskijs, dem auch zuzuschreiben ist, daß er die langjährige Aufführungszeit der Beet- hovenschen „Fünften” um etwa zwei Minuten unterbot.
Das sind zwar keine „Kleinigkeiten”, anderseits jedoch Unwägbarkeiten, deren Beurteilung ja auch letzten Endes aus dem persönlichen Geschmack des Referenten resultiert.
Aber etwas wollen und dürfen wir nicht vergessen: einen Dank an den Eugen Mrawinskij, der nicht nur ein glänzender Dirigent, sondern auch ein feiner, gebildeter und couragierter Künstler ist: Mit seinem Orchester hat er sich nicht nur unentwegt für das gesamte Werk Schostako- witschs eingesetzt, sondern auch Bėla Bartöks „Musik für Saiteninstrumente”, Paul Hindemiths Suite aus „Die Harmonie der Welt” sowie Arthur Honeggers „Synphonie liturglque” gespielt und auf Platten aufgenommen (Melodia/Eurodisc, im Vertrieb der Ariola, Wien).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!