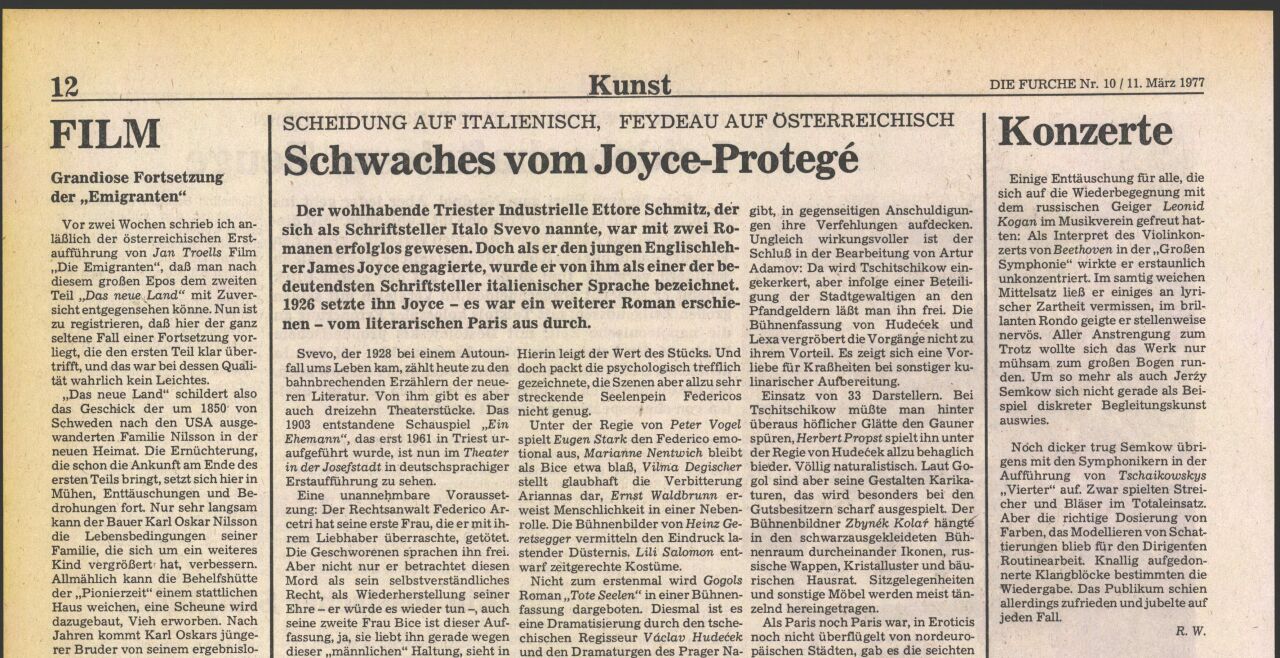
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schwaches vom Joyce-Protege
Der wohlhabende Triester Industrielle Ettore Schmitz, der sich als Schriftsteller Italo Svevo nannte, war mit zwei Romanen erfolglos gewesen. Doch als er den jungen Englischlehrer James Joyce engagierte, wurde er von ihm als einer der bedeutendsten Schriftsteller italienischer Sprache bezeichnet. 1926 setzte ihn Joyce - es war ein weiterer Roman erschienen - vom literarischen Paris aus durch.
Der wohlhabende Triester Industrielle Ettore Schmitz, der sich als Schriftsteller Italo Svevo nannte, war mit zwei Romanen erfolglos gewesen. Doch als er den jungen Englischlehrer James Joyce engagierte, wurde er von ihm als einer der bedeutendsten Schriftsteller italienischer Sprache bezeichnet. 1926 setzte ihn Joyce - es war ein weiterer Roman erschienen - vom literarischen Paris aus durch.
Svevo, der 1928 bei einem Autounfall ums Leben kam, zählt heute zu den bahnbrechenden Erzählern der neueren Literatur. Von ihm gibt es aber auch dreizehn Theaterstücke. Das 1903 entstandene Schauspiel „Ein Ehemann”, das erst 1961 in Triest ür- aufgeführt wurde, ist nun im Theater in der Josefstadt in deutschsprachiger Erstaufführung zu sehen.
Eine unannehmbare Voraussetzung: Der Rechtsanwalt Federico Ar- cetri hat seine erste Frau, die er mit ihrem Liebhaber überraschte, getötet. Die Geschworenen sprachen ihn frei. Aber nicht nur er betrachtet diesen Mord als sein selbstverständliches Recht, als Wiederherstellung seiner Ehre - er würde es wieder tun -, auch seine zweite Frau Bice ist dieser Auffassung, ja, sie hebt ihn gerade wegen dieser „männlichen” Haltung, sieht in ihm einen „Helden”. Eine Gans?
Was nun gezeigt wird, ist die innere Verbundenheit des Mörders mit seinem nicht mehr lebenden Opfer, er liebt die Tote und nicht die Lebende. Weshalb die Lebende - arg billig erdacht - techtelmechtelt, um ihn durch Eifersucht zu reizen, zu gewinnen und er ein Stück lang nicht weiß, ob er sie nicht doch töten „muß”. Das könnte ins Lächerliche umkippen, die Gefahr liegt sehr nahe, aber Svevo schien dies nicht zu spüren, er lenkt durch ein breites Darstellen der inneren Situation Federicos davon ab.
Aufgerührt durch den Verdacht gegen die zweite Frau, aufgerührt durch das Ansinnen, einen anderen Rächer seiner Gattenehre zu verteidigen, steht Federicos „Macht”, gegebenenfalls zu morden, in Konflikt mit dem Gewissen. Dabei zeigt sich eine seelische Vielschichtigkeit, die ständig diffundiert. Worte werden zu Selbsttäuschungen und kennzeichnen gerade dadurch Menschliches, Allzumenschliches. Das gilt auch für die Mutter Arianna der ersten Frau, die ihre Tochter rächt, indem sie in Federico den Verdacht gegen Bice schürt, ihn haßt und zugleich auch als Sohn liebt.
Hierin leigt der Wert des Stücks. Und doch packt die psychologisch trefflich gezeichnete, die Szenen aber allzu sehr streckende Seelenpein Federicos nicht genug.
Unter der Regie von Peter Vogel spielt Eugen Stark den Federico emotional aus, Marianne Nentwich bleibt als Bice etwa blaß, Vilma Degischer stellt glaubhaft die Verbitterung Ariannas dar, Emst Waldbrunn erweist Menschlichkeit in einer Nebenrolle. Die Bühnenbilder von Heinz Ge- retsegger vermitteln den Eindruck lastender Düsternis. Lili Salomon entwarf zeitgerechte Kostüme.
Nicht zum erstenmal wird Gogols Roman „Tote Seelen” in einer Bühnenfassung dargeboten. Diesmal ist es eine Dramatisierung durch den tschechischen Regisseur Vdclav Hudeček und den Dramaturgen des Prager Nationaltheaters, Jifi Lexa, die, in Prag uraufgeführt, im Volkstheater zur deutschsprachigen Erstaufführung gelangte. Die treffliche Übersetzung stammt von Karl Olschbauer und dem Chefdramaturgen des Volkstheaters, Heinz Gerstinger.
Was zeigt der Roman? Wie der angebliche „Kollegienrat” Tschitschi- kow mit fünf Gutsbesitzern verhandelt, um ihnen listenmäßig noch zu führende, verstorbene Leibeigene abzukaufen, die er, zu verpfänden beabsichtigt. Die fünfmal gleiche Situation, die zwar verschiedene Charaktere großartig aufschlüsselt, hat in der Bühnendarbietung den Nachteil, daß sie schließlich die Anteilnahme verringert. Die in dieser Fassung immer wieder zwischengeschalteten Szenen, die Tschitschikow in der fahrenden Kutsche zeigen, beheben den Nachteü nicht.
Dem Roman fehlt ein Schluß. Einen zweiten Teü, an dem Gogol zehn Jahre arbeitete, verbrannte er kurz vor seinem Tod. In dieser Bearbeitung wird Tschitschikow entlarvt, aber er zieht sich, allerdings nicht recht überzeugend, aus der Schlinge, worauf die Honoratioren, vor denen sich dies be gibt, in gegenseitigen Anschuldigungen ihre Verfehlungen aufdecken. Ungleich wirkungsvoller ist der Schluß in der Bearbeitung von Artur Adamov: Da wird Tschitschikow eingekerkert, aber infolge einer Beteiligung der Stadtgewaltigen an den Pfandgeldern läßt man ihn frei. Die Bühnenfassung von Hudeček und Lexa vergröbert die Vorgänge nicht zu ihrem Vorteil. Es zeigt sich eine Vorliebe für Kraßheiten bei sonstiger kulinarischer Aufbereitung.
Einsatz von 33 Darstellern. Bei Tschitschikow müßte man hinter überaus höflicher Glätte den Gauner spüren, Herbert Propst spielt ihn unter der Regie von Hudeček allzu behaglich bieder. Völlig naturalistisch. Laut Gogol sind aber seine Gestalten Karikaturen, das wird besonders bei den Gutsbesitzern scharf ausgespielt. Der Bühnenbildner Zbynėk Kolaf hängte in den schwarzausgekleideten Bühnenraum durcheinander Ikonen, russische Wappen, Kristallüster und bäurischen Hausrat. Sitzgelegenheiten und sonstige Möbel werden meist tänzelnd hereingetragen.
Als Paris noch Paris war, in Eroticis noch nicht überflügelt von nordeuropäischen Städten, gab es die seichten französischen Ehebruchskomödien. Sie müssen vor etwa einem halben Jahrhunder Alexander Lernet-Hole- nia gewaltig imponiert haben, denn er sagte sich wohl: Das kann ich auch. Und er konnte es sogar exzellent in der einaktigen Komödie „Ollapotrida”, dem „fauligen Topf” erotischen Schlamassels, der derzeit vom Volkstheater in den Wiener Außenbezirken dargeboten wird. Querbeziehungen über die Ehen hinweg machen es nötig, Frauen vor den Gehörnten in einem Nebenraum oder hinter einem Paravent zu verstecken, wobei der Spaß darin besteht, wie die Aufdek- kung trotz immer wieder vorstoßender Angriffe vereitelt wird. Lernet, sein eigener Feydeau. Vorher ist die ebenfalls einaktige Komödie „Flagranti” zu sehen: Gleiche Thematik, Fingerübung im kleineren Format.
Unter der Regie von Erich Margo wird „Ollapotrida” vorwiegend polternd ausgespielt, „Flagranti” bleibt vorweg etwas verhaltener. Etwa gleichwertige Leistungen der zehn Darsteller. Inge Justin entwarf schlichte Bühnenbilder und die Kostüme der zwanziger Jahre.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































