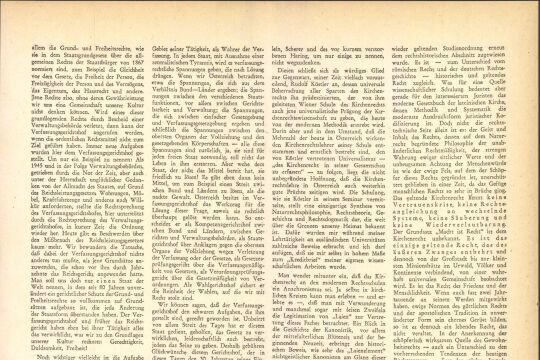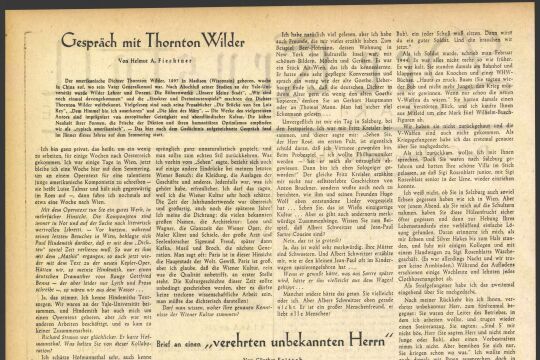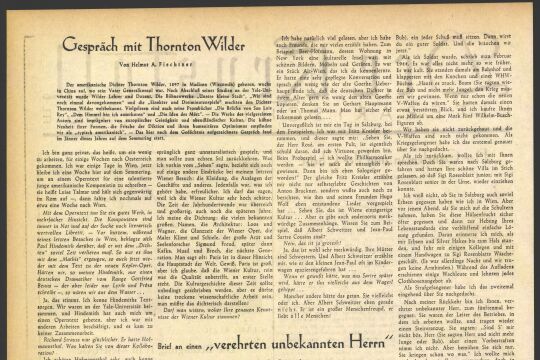Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schwächliche Rückblicke
In der Ausstellung des Wiener Bürgerlichen Zeughauses auf der Schallaburg ist unter anderem ein Nationalgardesäbel des Jahres 1848 zu sehen, auf dem zu lesen ist: „Stirb für das Volk, doch nie für einen Fürsten!“ Das ist der Geist, dessen Niedergang Hermann Sudermann in der vor 75 Jahren geschriebenen Komödie „Sturmgeselle Sokrates“ darstellte, die im Akademietheater Premiere hatte.
Fünf alte „Sturmgesellen“, Revolutionäre des 48er-Jahrs, treffen sich noch nach 30 Jahren als Geheimbund ständig in einem Gasthaus, um ihre Ideale von einst hochzuhalten. Das nun macht Sudermann lächerlich, sie trinken Bier, zwicken die Kellnerin, ein Zahnarzt mit dem nom de guerre „Sokrates“ gerät immer wieder in weihevolle Stimmung und berauscht sich an den zu Phrasen abgesunkenen Idealen. Gerade er bekommt, durch eine Verkettung besonderer Umstände, vom Fürsten einen Orden.
Aus Äußerungen Sudermanns ist zu erkennen, daß ihn dieses Verkommen der Haltung von einst schmerzte, dadurch aber wird das Stück dieses Theaterpraktikers unausgeglichen, mischt sich Ernstes mit Komödienhaftem und ausgesprochenen Schwankmotiven. Das könnte wirken, würde aber Tiefgang verlangen, was Sudęr- mann überfordert hätte. Gibt es nun einen Bezug zu uns? Kaum. Daß sich Revolutionäre von 1918 später verbürgerlichten, hat mit den „Sturmgesellen“ wenig zu tun. Und eine Parallele zu den Geheimbünden von heute, die zu Mörderorganisationen wurden, gibt es nicht. Das Stück bietet einen Rückblick, Vergangenes ersteht.
Die Aufführung unter der Regie von Michael Kehlmann zeichnet sich vor allem durch schauspielerische Leistungen aus. Das gilt besonders für den blind schwärmerischen Zahnarzt von Paul Hoffmann, den ungleich bedächtigeren Rabbiner von Manfred Inger, den diktatorischen Vorsitzenden der „Sturmgesellen“, Otto Collin, wie für Erich Aberle als sie bedrohenden Landrat. Eine allzu gutmütige Kellnerin macht Ulli Fessl glaubhaft. Die Bühnenbilder von Hans-Ulrich
Schmückte, die Kostüme von Sylta Busse entsprechen der Zeit.
Kaum zu glauben: Die Stücke des eminenten Theaterpraktikers Jean Anouilh, der auch einmal ein Bühnendichter war, beginnen mehr und mehr zu langweilen. Nun schrieb auch er ein bis knapp vor Schluß handlungsloses Stück, „Das Drehbuch“, das im Theater in der Josefstadt zur deutschsprachigen Erstaufführung gelangte. Handlungslose Szenen müssen keineswegs der Spannung entbehren, hier fehlt sie aber völlig. Zwei Drehbuchautoren haben sich in einen Landgasthof zurückgezogen, sitzen vor dem Gasthof herum, versuchen einen Filmstoff zu entwickeln, was nicht recht gelingt, die Gattinnen sind dabei, fast alle reden irgendeinmal von sich. Das packt nicht, mögen die Gestalten auch gut gezeichnet sein. Nur wenn der Filmproduzent, der hinzukommt, die vage Filmidee zweimal verschieden nach Kommerzbedürfnissen umformt, läßt dies aufhorchen: Bloßstellung des Filmgeschäfts. Aber das ist für einen Abend zu wenig.
Nun begibt sich dies knapp vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Im Radio hört man immer wieder’ Hitler. Wozu? Kein innerer Grund. Alle Pläne scheitern des Krieges wegen. Schließlich trägt man noch einen Sarg aus dem Gasthof, der eine Drehbuchautor, ein Säufer aus kaum ausgesprochener Verzweiflung, hat sich erschossen. Aufgeklebtes Symbol für das Kommende.
Herbert Kreppei inszenierte das Stück mit hier nicht gerechtfertigter Hochachtung vor dem Autor. Leopold Rudolf und Sieghardt Rupp zeichnen glaubhaft die unterschiedlichen Charaktere der beiden Drehbuchautoren. Vorzüglich Michael Toost als jüdischer Fümproduzent. Eine der Frauengestalten, die sich stärker heraushebt, spielt Marion Degler. Ein offenbar gewollt etwas düsteres Bühnenbild wurde von Gottfried Neumann-Spallart entworfen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!