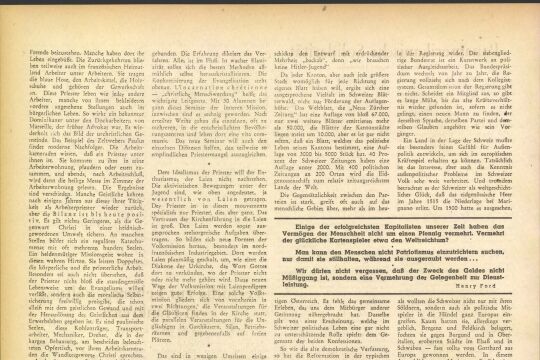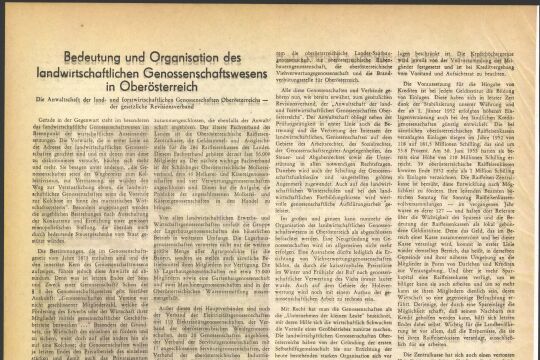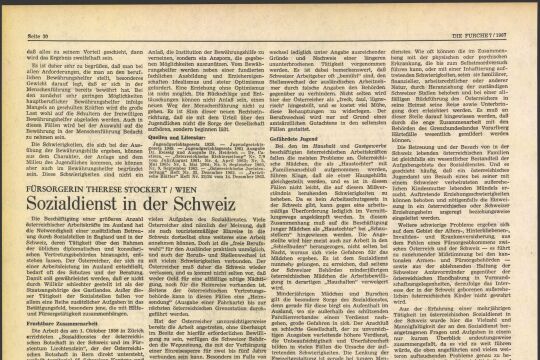Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Elastischer Krankenschutz in der Schweiz
Auf den ersten Blick mag es verwundern, daß die Schweiz, das Land einer hochentwickelten medizinischen Wissenschaft und einer Reihe vorbildlicher privater und staatlicher Wohlfahrtseinrichtungen, keine obligatorische Krankenversicherung besitzt. Wie ist das zu erklären? Ist die Schweiz zu weit von England und seinem vieldiskutierten Gesundheitsdienst entfernt? Glaubt sie, einer Pflichtversicherung für ihre Bevölkerung und somit eines wirksamen Schutzes für ihre Kranken entbehren zu können? — In der Schweiz, in der naturgewachsenen Demokratie, ist jede Einmischung in das private und bürgerliche Leben der Einwohner verhaßt. Man lehnt jede Kollektivisierung, soweit man es sich leisten kann (und man kann es noch in vielem), entschieden ab. Man setzt allen staatlichen Bestrebungen, die Einfluß auf die private Sphäre des Staatsbürgers gewinnen wollen, wachsamen Widerstand entgegen. Das bezeugt beispielsweise die bereits zweimalige Verwerfung des Tuberkulosefürsorgegesetzes in jener Fassung, wie sie die Regierung als Gesetzesvorlage dem Volk zum Entscheid vorgelegt hat. Das bezeugt weiter — ein nicht sehr fortschrittlicher Konservativstandpunkt in unserer Zeit —• das wiederholte Ablehnen des vorgeschlagenen Frauenstimmrechts.
An dieser Grundeinstellung des Schweizer Bürgers scheiterte bis jetzt auch jeder Versuch einer Einführung des allgemei- 'nen obligatorischen Krankenschutzes. Wohl besteht Krankenversicherungspflicht für jene zahlenmäßig sehr geringe Bevölkerungsschichte, deren monatliches Einkommen das Existenzminimum von vierhundert Franken pro Kopf nicht erreicht. Der Stand dieser obligatorisch Krankenpflegeversicherten betrug nach einer Statistik der letzten Jahre nicht ganz 200.000, davon 82.000 Frauen, 55.000 Männer und 42.000 Jugendliche unter 18 Jahren — im Vergleich zu den vier Millionen Einwohnern der Schweiz ein bescheidener Prozentsatz. Alle übrigen Schweizer kennen die obligatorische Krankenversicherungspflicht nicht. Leben aber nun wirklich alle von ihnen in so guten Einkommensverhältnissen, daß sie sich im Ernstfall den teuren Arzt, das teure Krankenhaus und die teuren Medikamente leisten können? Die Schweiz besitzt eine Reihe betrieblicher Krankenkassen, von denen wieder jene, die vom
Staate anerkannt werden, staatliche Subventionen genießen, und vom Staate kontrolliert werden. Diese und auch die zahlreichen privaten Krankenkassen, die auf der Basis eines genossenschaftlichen Zusammenschlusses gegründet werden, haben sich in der Praxis außerordentlich gut bewährt. Sie heben die freiwilligen Beiträge ihrer Mitglieder in Form direkter Beitragsleistungen als Bringschuld ihrer Mitglieder monatlich ein (wobei die Beiträge der verschiedenen Kassen verschiedentlich hoch, aber niemals sehr hoch sind), und leisten bei jedem Versicherungsfall rasche und ergiebige Hilfe. So ist es kein Wunder, daß in diesen freiwilligen Krankenkassen schon seit einer Reihe von Jahren drei Viertel des Schweizer Volkes freiwillig versichert sind. Eine Statistik aus dem Jahre 1938 zählte damals schon 2,033.400 Versicherte, das sind 48,6 Prozent der Bevölkerung. Seither hat sich der Mitgliederstand nicht verringert. Auch die 1147 vom Bund anerkannten Krankenkassen sind ein beredtes Zeugnis fruchtbarer Privatinitiative. Sie sind privatrechtliche und zum großen Teil staatlich konzessio-
nierte Unternehmungen, und der Unternehmergeist schafft auch den Pioniergeist zur Verbesserung der Leistungen und damit zur größeren freien Mitgliederwerbung.
Zu dieser gesunden und von jeder Trustbildung entfernten Struktur des Versicherungswesens, das übrigens in den verschiedenen Kantonen und Gemeinden verschieden gehandhabt wird, kommt eine klare Unterscheidung von Billigkeit und Recht, wobei Billigkeit oft genug auch für Recht gesetzt wird. Kompetenzstreitigkeiten, wer für wen zahlt, sind selten. Der Arbeitgeber zum Beispiel zahlt seinem erkrankten Arbeitnehmer im Falle einer Krankheit, auch wenn sich diese über mehrere Monate erstreckt, die vollen Gehaltsbezüge aus, gleichgültig, ob er sonst auch noch krankenversichert ist oder nicht. Die Krankenkasse dagegen hält sich an ihre Weisungen, im Falle der Erkrankung eines Mitgliedes sofort für alle Kosten, wobei es bei Notwendigkeit auch die» teuersten sein dürfen, aufzukommen. Es ist klar, daß der Vorteil bei dem Versicherten liegt. Es wäre schön, wenn man das gleiche von dem österreichischen Versicherungsnehmer behaupten könnte.
Für die Bemessung der Tages- und Behandlungssätze in den einzelnen Krankenanstalten des Landes besteht im allgemeinen kein einheitlicher Gebührensatz, vielmehr wird die Anrechnung der Gebühren und Verpflegssätze nach der Höhe des Steuerbekenntnisses, also des Einkommens oder Vermögens, vorgenommen. Danach stellt sich ein Krankenhausaufenthalt für den Zahlungsfähigen ziemlich hoch, während der Minderbemittelte oder Zahlungsunfähige in den Kantonsspitälern freie Station und Behandlung genießt.
In diesem Zusammenhang sind noch die fürsorgerischen Einrichtungen der schwei-
zerischen Gemeinden und Kantone lobend zu erwähnen. Die Stadt Zürich gibt zum Beispiel in einem Vierteljahr rund zweieinhalb Millionen Schweizerfranken für Befürsorgung der in ihrem Stadtbezirk lebenden Bedürftigen aus: andere Kantone und Städte nicht viel weniger. Auch hier liegt die Initiative bei den unmittelbar fürsorgerischen Sektoren, weniger in einer gesetzlich erstarrten bundeseinheitlichen staatlichen Fürsorge. Im Sozialversicherungswesen, das in der Schweiz verhältnismäßig gering ausgebaut ist, ist als neues Gesetz in den letzten Jahren lediglich die Alters-Hinterbliebenenversorgung mit indirekter Steuereinhaltung von jedem Einzeleinkommen zu nennen.
Im Gegensatz zu dem nicht allgemeinen Krankenversicherungsobligatorium kennt das schweizerische Bundesgesetz seit 1911 die obligate Unfallversicherung. Ihr waren zum Beispiel schon im Jahre 1940 (heute viel mehr) 50.895 Betriebe mit einer Prämienleistung von 44,5 Millionen Schweizer Franken angeschlossen.
Ist der praktische Arzt in der Schweiz auf eine „Krankenkassenpraxis'' angewiesen? In unserem Sinne nicht. Bei der Behandlung eines Versicherten im Gegensatz zu einem Nichtversicherten verlagert sich lediglich die Bezahlung der (gleichen) Honorare von der Person auf die Kasse. Das ist alles. Differenzierungen, wie sie in Staaten mit Pflichtversicherung zum Schaden des Patienten und des Arztes an der Regel sind, gibt es hier also nicht. Daher auch keine erfolglosen Dispute darüber. Der praktische Arzt gehört, wenn er nach den schwierigen Anfängen erst einmal eine eigene Praxis erworben hat, nach der Steuerstatistik zu der bestbezahltesten Intelligenzschichte der Schweiz. Neidvoll blicken die österreichischen Kollegen auch hierin über die Grenze,
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!