Eine UN-Konferenz wollte den Waffenhandel beschränken. Einziges Ergebnis aber war die neuerliche Einsicht, wie stark beschränkt die Möglichkeiten der Vereinten Nationen sind.
Über 500.000 Menschen, größtenteils Zivilpersonen, werden jährlich durch kleine und leichte Waffen (Revolver, Gewehre, Pistolen und leichte Maschinengewehre) getötet. Kleine und leichte Waffen sind damit zum Tötungsmittel Nummer eins geworden. Weltweit wird die Zahl der kleinen und leichten Waffen auf 550 Millionen geschätzt, der Handelswert des legalen Handels mit diesen Waffen auf vier bis sechs Milliarden Dollar. Über 600 Waffenfabriken (1980 waren es noch 196) in mindestens 95 Staaten sind legale Waffenproduktionsstätten. Es gibt drei große (USA, Russland, China), 23 mittlere (darunter Österreich) und zahlreiche kleine Produktionsstaaten.
Seit den sechziger Jahren ist der Welthandel mit kleinen und leichten Waffen zu einem enormen Geschäftszweig angewachsen, ein weiterer Schub trat mit der politischen Wende Ende der achtziger Jahre ein. Die Produktion ging zwar in den ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten drastisch zurück, aber allein die Waffenbestände, die Privatisierung und die Internationalisierung der Produktionsstätten und die daraus resultierenden neuen Exportmöglichkeiten stellen weitere Risikofaktoren dar. Diese Risikofaktoren mit legistischen Mitteln zu verringern, war das Ziel der letzten Freitag zu Ende gegangenen UN-Konferenz "The Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects" in New York.
Alte US-Waffen für Entwicklungsländer
Gleich vorweg, die Ergebnisse der Tagung waren enttäuschend: Die Delegierten der USA haben sich geweigert, einer vorgelegten Definition von "überflüssigen Waffen" zuzustimmen. Auch mit dem Vorschlag, vorhandene Bestände an Klein- und Leichtwaffen unbrauchbar zu machen und zu entsorgen, kann sich Washington nicht anfreunden. Verständlich wird diese Haltung, wenn man weiß, dass das US-Außenministerium erst jüngst eingeräumt hat, dass die USA die meisten Waffen, die nicht mehr gebraucht werden, im Rahmen des Programms für die Verwendung von "überschüssigen Verteidigungsartikeln" an Entwicklungsländer transferiert. "Dieses Programm kostet die USA praktisch nichts, denn die Empfänger kommen für Wartung und Reparatur des Geräts ebenso auf wie für die Transportkosten", heißt es aus dem Außenministerium. Außerdem habe das Programm zu außenpolitischen Erfolgen der USA geführt. Auch zu einer staatlichen Verpflichtung zur Restriktion (statt ursprünglich "Verbot") des Verkaufs von eindeutig für militärische Zwecke hergestellten Waffen an Zivilpersonen wollten die US-Vertreter nicht zustimmen. Ein Blick in die Statistik erklärt die US-Haltung: So besteht die größte Waffendichte in den USA mit 84 Gewehren auf 100 Einwohner. Davon sind 97,7 Prozent in Privatbesitz und nur 2,3 Prozent im Besitz von Militär und Polizei.
Immerhin haben die USA am Verschleudern von nicht mehr benötigten Waffen und militärischem Gerät gut verdient. Das Allgemeine Rechnungsamt in Washington veranschlagt die dadurch seit 1989 erzielten Einnahmen auf mehr als drei Milliarden Dollar. Aber auch Russland verdient am Handel mit überschüssigen Waffen. Es konnte durch Waffenverkäufe im Wert von 1,2 Milliarden Dollar finanzielle Altlasten tilgen, mit denen die Sowjetunion beim Gläubiger China in der Kreide gestanden hatte.
Neben den Staaten sind die Waffenhändler und -schieber die Profiteure. Die Szene der "Arms Broker" verfügt über eine hoch entwickelte Logistik und weltweite Netzwerke. Neben klar illegalen Transfers gibt es eine enorme Grauzone, das heißt: Waffen werden über ein Legal-Export-Land in illegale Zielländer verschoben. Die Untergrundbewegungen UNITA in Angola und die RUF in Sierra Leone waren in den letzten Jahren die wichtigsten Zielgruppen illegaler Waffentransfers aus Osteuropa. Während in früheren Jahren ideologische Gründe ein wichtiger Motor des Waffenhandels waren (Unterstützung von Revolutions- beziehungsweise Befreiungsbewegungen), überwiegen heute kommerzielle Motive.
Viele Staaten setzten sich bei der UN-Konferenz auch für eine Folge-Tagung im Jahr 2006 ein, um gesetzlich bindende Konventionen auszuverhandeln und um die Waffenschieber mit einem legalen Instrument kontrollieren sowie die Handelswege der Waffen verfolgen zu können. Gegen diese Konferenz sprachen sich erneut die USA aber auch China aus. Der belgische EU-Delegierte Jean Lint bedauerte, dass die vorrangigen Anliegen der EU, nämlich Exportkontrolle und Indikatoren für Waffenüberschüsse gar nicht in der vorgesehenen Weise im Abschlussdokument enthalten sind.
Wichtig festzuhalten ist jedoch, dass eine Strategie zur Kontrolle des Waffenhandels nur erfolgreich sein kann, wenn nicht nur Negatives eingeschränkt wird; es müssen auch positive, konstruktive Ansätze geschaffen werden. Das heißt: Statt in Waffen in Sozial- und Wirtschaftsprojekte investieren, um den Verzweifelten eine friedliche Überlebenschance zu ermöglichen. Hinzu kommt die Förderung der Resozialisierung. Die mageren Ergebnisse der UN-Konferenz bedeuten aber vor allem, dass alle Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), die sich zu Anwälten der Waffenopfer machen, weiterhin das couragierte Auftreten einzelner engagierter Diplomaten aus verschiedener Staaten benötigen werden, um das Elend längerfristig verringern zu können.
Der Autor
ist Präsident der österreichischen Sektion der Internationalen Ärzte gegen Atomkrieg und Vorsitzender des Friedens-Komitees der Nicht-Regierungs-Organisationen bei der UNO in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


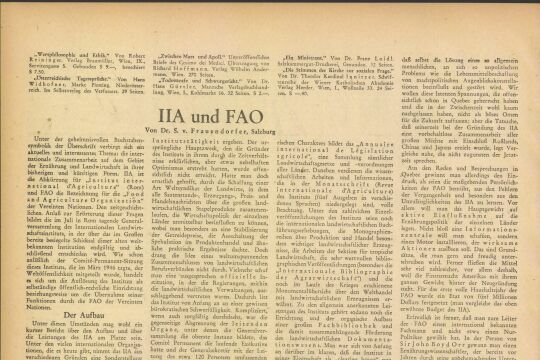





























































%20(2).png)




























