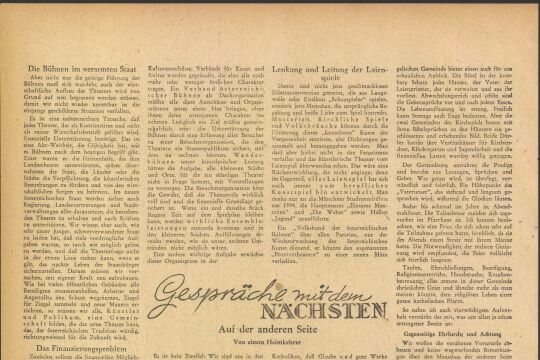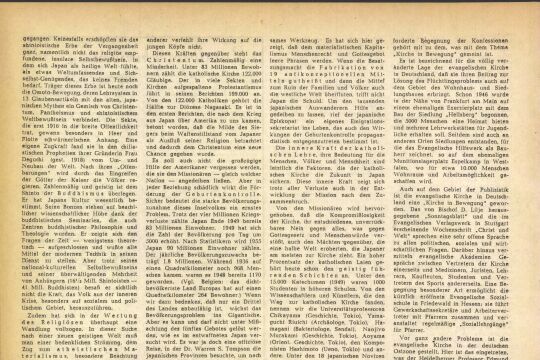Der evangelisch-lutherische Landesbischof von Berlin-Brandenburg, Wolfgang Huber, zur Lage der Ökumene - vom Verhältnis zwischen Rom und den Lutheranern bis zum Ökumenischen Kirchentag 2003 in Deutschland. Trotz mancher Turbulenzen - wie um das römische Dokument "Dominus Iesus" - ist die Ökumene keineswegs obsolet; es geht Huber dabei aber nicht um eine Einheitskirche, sondern um das "Modell der versöhnten Verschiedenheit".
Die Furche: Was kann ein katholischer Christ von Martin Luther lernen?
Landesbischof Wolfgang Huber: Es gehört zu den großen Hoffnungszeichen der letzten Jahre, dass im ökumenischen Dialog katholische Christen von der reformatorischen Tradition die starke Betonung der Rechtfertigung des Menschen durch Gottes Gnade allein neu aufgenommen haben. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungungslehre von 1999 ist dafür ein deutliches und sehr positives Signal.
Damit verbunden ist die reformatorische Entdeckung der Freiheit eines Christenmenschen: Dass jeder Christ als ein von Gott angesprochener, ihm antwortender Mensch in die Freiheit gerufen und dadurch zur Verantwortung seines Glaubens befähigt ist. Das ist etwas, was katholische Christen von der reformatorischen Tradition, von den evangelischen Christen lernen können.
Die Furche: Und umkehrt, was können, sollen Protestanten von Rom lernen?
Huber: Die große Bedeutung, die es hat, eingegliedert zu sein in den Leib Christi. Den Glauben nicht allein zu leben, sondern in der Gemeinschaft der Glaubenden miteinander verbunden zu sein: Das können evangelische Christen von der katholischen Kirche lernen. Weil evangelische Christen immer wieder dazu neigen, den Glauben als eine eigene Sache anzusehen, die man nur für sich selber hätte.
Damit hängt unmittelbar zusammen, dass evangelische Christen neu lernen und dabei viele Anregungen auch aus der katholischen Kirche aufnehmen, etwa, dass das Feiern des Gottesdienstes, die gestaltete Liturgie, das Gleichmaß auch der Liturgie über die Jahrhunderte hinweg, ein kostbares Gut ist: Das lernen wir in der ökumenischen Gemeinschaft neu und das ist für uns als evangelische Christen und als evangelische Kirche sehr wichtig und kostbar.
"Das hat geschmerzt ..."
Die Furche: Ist durch die römische Erklärung "Dominus Iesus" vor zwei Jahren die Annäherung zwischen Katholiken und Lutheranern ernsthaft in Frage gestellt worden?
Huber: Ernsthaft in Frage gestellt wurde ein Bild von Ökumene, das an der Einheitsökumene ausgerichtet ist - eine Vorstellung, die sagt: "Ökumene lässt sich nur so verwirklichen, dass wir auch in einem organisatorischen Sinn zu einer Einheit werden." "Dominus Iesus" hat evangelische Christen und die evangelische Kirche auf die Notwendigkeit gestoßen, ihr eigenes Kirchenverständnis, die eigene Art der Bindung ans Evangelium, selbstbewusst in die Ökumene einzubringen. Das bedeutet, nicht nur darauf zu schauen, wie man Erwartungen von katholischer Seite erfüllen kann, sondern wie man ein selbstständiger Dialogpartner ist. Wir haben im Zusammenhang der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre gelegentlich davon gesprochen, dass der ökumenische Dialog auf Augenhöhe stattfinden müsse. "Dominus Jesus" ist von vielen so wahrgenommen worden, dass aus katholischer Perspektive den anderen Kirchen, insbesondere den Kirchen der Reformation, diese gleiche Achtung auf Augenhöhe verweigert wird. Das hat geschmerzt.
Die Furche: Kardinal Ratzinger hat in einem Interview dazu präzisiert, auch aus lutherischer Sicht könnte man nicht bezweifeln, dass die beiden Kirchen - jeweils gemessen an ihrem eigenen Kirchenverständnis - die andere Kirche nicht im selben Sinn als Kirche ansehen, wie sie sich selbst als Kirche verstehen.
Huber: Ja, und das ist eine Einladung, nun auch aus reformatorischer Sicht unser Kirchenverständnis mit Selbstbewusstsein einzubringen. Das ist übrigens in einer, wie ich zugebe, etwas schroffen Form in dem Dokument unserer Kirche "Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis" geschehen.
Manche haben gesagt: "Jetzt ist wieder ein Gleichklang hergestellt." In der Sache unterstreiche ich nicht ein Einheitsmodell, sondern das Modell der versöhnten Verschiedenheit, der Dialogfähigkeit auf dem Hintergrund unterschiedlicher Traditionen, die Aufgabe, das Evangelium gemeinsam zu bezeugen, in einer Weise, in der wir unsere Unterschiedenheit auch sehr wohl im Bewusstsein haben.
Die Furche: Wie schätzen Sie den Stand der Ökumene generell ein? Wo und wer sind heute die Motoren dazu?
Huber: Was die Rolle der römisch-katholischen Kirche betrifft, sind meine ökumenischen Hoffnungen sehr stark durch die inspirierende Gestalt von Johannes XXIII. geprägt worden. Das II. Vatikanische Konzil hat diejenige Art von ökumenischen Hoffnungen in mir bestärkt, von denen ich nicht mehr lassen will. Dabei gehört zu den grundlegenden Erfahrungen, dass sich als Motor der Ökumene immer wieder die gelebte Ökumene vor Ort erwiesen hat. Gemeinden in unmittelbarer Nachbarschaft, die nach der Regel leben, dass sie so viel gemeinsam tun, wie sie gemeinsam tun können; die Erfahrung in der Kirchentagsbewegung, die jetzt hingeführt hat auf den ökumenischen Kirchentag nächstes Jahr in Berlin.
Diese Ökumene vor Ort, auch in Familien, die mich zum Teil sehr beeindrucken, die konfessions- verbindend miteinander ihren Glauben leben und dabei ihre jeweilige Herkunftsprägung nicht verleugnen: darin liegen die wirklichen Anriebskräfte. Die theologische Lehre einerseits, das kirchenleitende Amt andererseits, haben die Aufgabe, diese Prozesse zu begleiten und dann immer wieder ihre Grenzen und ihre Richtung mit zu beeinflussen, aber sie haben nicht die Aufgabe, diese Prozesse im Prinzip zu hindern oder gar unmöglich zu machen. Und da anerkenne ich - bei allem, was man vielleicht noch zusätzlich an Fragen auf dem Herzen haben mag: Papst Johannes Paul II. steht für eine Grundhaltung, die jedenfalls nicht darauf gerichtet ist, Ökumene zu hindern oder zu bremsen.
Papst als Christensprecher?
Die Furche: Der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich hat jedenfalls den Papst als Ökumenischen Sprecher der gesamten Christenheit ins Spiel gebracht.
Huber: Landesbischof Friedrich hat sich damit beteiligt an einer Diskussion über den Dienst des Bischofs von Rom, den Petrusdienst an der Ökumene. Dabei ist diese Vorstellung vom Papst als Sprecher der Christenheit eines der Denkmodelle. Ich gebe freimütig zu, dass ich diese Diskussion zu einem Teil für verfrüht halte, wir müssten erst einmal in der Ökumene so weit sein, dass wir wüssten, in welchem Sinne wir den gemeinsamen Sprecher brauchen. Man darf nicht vergessen, dass wir im Ökumenischen Rat der Kirchen Erfahrungen mit dieser Sprecherfunktion haben, bei denen sich herausstellte: Wenn wir die unterschiedlichen Konfessionsfamilien der Erde - darunter die beiden großen orthodoxen Familien -, wenn wir die Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche berücksichtigen wollen, dann ist die Vorstellung von dem einen Sprecher in sich selbst keineswegs unproblematisch.
Ich akzeptiere, dass es für Katholiken eine sehr nahe liegende Vorstellung ist. Aber sie hat gar nicht die Selbstverständlichkleit, die man ihr dabei unterstellt. Deswegen sage ich im vollen Respekt für die herausgehobene Bedeutung des Papstes - nicht nur für die römisch-katholische Kirche, sondern auch darüber hinaus: Das Denkmodell des einen Sprechers sollten wir erst dann wieder aufnehmen, wenn wir mehr über die intensivere Gestalt der Gemeinschaft zwischen den großen Familien der Weltchristenheit wissen.
Die Furche: 2003 findet in Berlin der Ökumenische Kirchentag, der erste evangelisch-katholische Kirchentag der Geschichte statt. Mit dem Leitwort: "Ihr sollt ein Segen sein" wird eigentlich ein hoher Anspruch vorgegeben.
Huber: Das biblische Wort "Ihr sollt ein Segen sein", ein Wort aus der Verheißung Abrahams, ist ja zunächst einmal nicht ein hoher Anspruch, sondern eine grundlegende Zusage. Ihr "sollt" meint dabei nicht so sehr: ihr "müsst" jetzt selber durch euer eigenes Handeln dafür sorgen, dass ihr ein Segen seid, sondern: euch ist die Verheißung gegeben, ein Segen zu sein. Lebt im Horizont dieser Verheißung, bezeugt euren Glauben im Horizont dieser Verheißung. Werdet, was ihr schon seid.
Gerade in Berlin kann man das anders gar nicht machen, das ist in Deutschland die Stadt mit der größten Vielfalt an christlichen Glaubensgemeinschaften. Wenn immer jemand sagt, Berlin sei doch eine atheistische Stadt, dann sage ich: Es ist zunächst einmal eine Stadt, in der man den Reichtum gottesdienstlichen Lebens, christlichen Lebens, im Horizont der Ökumene intensiver erleben kann als irgendwo anders in Deutschland. Aber es ist gleichzeitig diejenige Stadt, in der das Zeugnis des christlichen Glaubens in einer glaubensfremd und gottfern gewordenen Umwelt besonders dringlich ist. Dass wir dieses Zeugnis gemeinsam ablegen können, dass wir uns gemeinsam unter die Zusage stellen, die dieses Losungswort enthält, dass wir gemeinsam versuchen, den Glauben auch öffentlich zu bezeugen, der uns geschenkt, uns anvertraut ist, das finde ich die einzigartige Herausforderung, die mit dem Ökumenischen Kirchentag 2003 verbunden ist.
Gemeinsames Abendmahl?
Die Furche: Rund um den Kirchentag wurde und wird auch die Frage des gemeinsamen Abendmahls thematisiert: Liegt hier ein Grundproblem ökumenischen Verständnisses vor?
Huber: In der Frage des gemeinsamen Abendmahls haben wir ein zentrales Thema des ökumenischen Weges, auf dem wir uns befinden. Wir müssen mit Nüchternheit und Hoffnung und zugleich mit ökumenischer Geduld und ökumenischer Ungeduld immer wieder uns klar machen, an welcher Stelle die-ses Weges wir uns befinden. Die Schwierigkeit ist hier besonders offenkundig: sie hängt damit zusammen, dass wir eine gewisse Asymmetrie zwischen katholischer und evangelischer Haltung zu diesem Thema nicht verkennen können.
Die römisch-katholische Kirche lehnt die Vorstellung von einem gemeinsamen Abendmahl ab, weil sie die Kirchengemeinschaft als Voraussetzung der eucharistischen Gemeinschaft ansieht, und weil sie Kirchengemeinschaft von der Verbundenheit mit demselben kirchlichen Amt her versteht. Die evangelische Kirche hat in einer langen und keineswegs bruchlosen Entwicklung zu einem Verständnis des Heiligen Abendmahls gefunden, das geprägt ist von der Gegenwart Jesu Christi selbst in Brot und Wein. Das geprägt ist von daher, dass Er selbst an seinem Tisch einlädt. Deswegen ist die Stellung Christi, als des Einladenden, mit Vorrang ausgestattet gegenüber den Unterschieden im Verständnis des Amts derjenigen, die ihm an diesem Tisch dienen. Wir verstehen das ordinierte Amt in diesem Zusammenhang als einen Dienst Jesu Christi, und seine Einladung, weiterzugeben, ist die vorzüglichste Aufgabe dieses Amtes.
Deswegen sagen wir, genauso wie die anglikanische Kirche auch an jedes Kirchengebäude ausdrücklich dranschreibt: "Zugelassen zu unserer Abendmahlsfeier, und eingeladen ist jeder getaufte Christ und jede getaufte Christin, die nach den Regeln der eigenen Kirche zum Abendmahl, zur Eucharistie zugelassen ist." Wir sagen das in aller Behutsamkeit, nicht im Sinne einer Pression, aber wir würden das Abendmahl uns selber zum Gericht essen, wenn wir diesen unseren Glauben und unsere Einsicht verschweigen und verleugnen würden.
Mit diesem Unterschied nun in guter ökumenischer Gemeinschaft umzugehen, jeweils die Haltung des anderen zu respektieren, auch an der Stelle, an der wir sie nicht teilen, ist die große Aufgabe des Ökumenischen Kirchentags; ich hoffe, dass auch in der gottesdienstlichen Gestalt dieses Kirchentags davon etwas zu spüren sein wird. Ein Fehler wäre es, wenn wir das Gesamtgeschehen des Kirchentags auf dieses eine Thema reduzieren würden. Das Geschehen wird reicher und vielfältiger sein, aber ich hoffe, es wird überzeugend sein, auch gerade in dem, wo wir sagen: Wir sind noch auf dem Weg, wir sind noch nicht am Ziel.
Das Gespräch führte
Aldo Parmeggiani.
RADIO-TIPP: Menschen in der Zeit.
Aldo Parmeggiani im Gespräch mit Landesbischof Wolfgang Huber.
Sonntag, 1. September, 20.20, bzw. Montag, 2. September, 6.20
RADIO VATIKAN (MW 1530 & 1467 kHz; KW 5890, 7250, 9645 kHz)
Wessi als Ost-Bischof
Wolfgang Huber wurde 1942 in Straßburg geboren. Nach dem Theologiestudium in Heidelberg, Göttingen und Tübingen schlug er die wissenschaftliche Laufbahn ein, habilitierte sich und arbeitete für theologische Forschungsstätten, als Professor für Sozialethik und Theologie lehrte er in Heidelberg. 1993 wurde Wolfgang Huber zum Bischof der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg gewählt. In einer Situation, in der sich diese Landeskirche mit der Stasi-Vergangenheit ihrer Pfarrer auseinanersetzen musste, wurde ein "Wessi" Bischof mitten im "Ossi"-Land.
Huber galt - nicht zuletzt wegen seiner Haltung in Friedens- und Sozialfragen - lange als "links"; in Heidelberg hatte er sich auch bei der SPD engagiert, die Parteimitgliedschaft ruht, seitdem er Bischof ist.
Doch ebenso engagiert setzte und setzt Huber Akzente in der biopolitischen Debatte - für einen umfassenden Embryonenschutz oder gegen die aktive Sterbehilfe ein. Huber wehrt sich gegen die politische Etikettierung und bezeichnet sich selbst als sozialen Demokraten, dem die liberalen Freiheitsrechte ebenso wichtig sind wie soziale Gerechtigkeit.
Aufsehen erregte 1999 auch das Gespräch, das Landesbischof Huber mit Kardinal Joseph Ratzinger in der evangelischen Kirche in Rom öffentlich austrug.