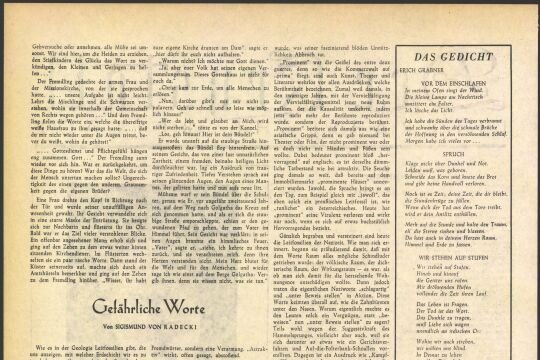Ein Plädoyer für die Gier und die Überwindung des Denkens in Alternativen.
Wenn mich meine Eltern als Kind in die Konditorei ausführten, musste ich mich entscheiden: entweder Cremeschnitte oder Schaumrolle, entweder Punschkrapfen oder Rehrücken, entweder Baiser mit Schlag oder Ischler Tortelette. Ich wollte alles haben. Einmal – das sollte eine erzieherische Maßnahme sein – durfte ich so viele Leckereien auswählen, wie ich wollte. Mein Vater hoffte, ich würde mich sosehr überessen, dass ich für alle Zeiten die Lust, wenn nicht an Süßigkeiten, so doch an der Völlerei verlöre. Der Erfolg war nicht von langer Dauer. Meine Gier blieb maßlos. Und sie ist, bis heute, nicht auf Konditorwaren beschränkt.
Shakespeare vs. Hader
Bach oder Charlie Parker? Verdammt noch mal, warum darf ich nicht beide lieben? Alfred Deller oder Van Morrison? Schließt der eine den anderen aus? Gidon Kremer oder Eric Clapton? Warum sollten die sich nicht vertragen? Dürfen mich Mozarts Requiem oder ein Klaviertrio von Schubert nicht zu Tränen rühren, weil mich Chick Corea (der übrigens kein Entweder-Oder kennt) oder Goran Bregovi´c in Begeisterung versetzen? Wenn ein Jazzmusiker in Donaueschingen auftritt und in Saalfelden oder gar in Montreux: Ist er dann in dem einen Fall gut und im anderen böse (oder umgekehrt), und bedarf es eines Bekenntnisses zur einen oder zur anderen Fraktion? „Die Winterreise“ und die Lieder von Franz Josef Degenhardt? Was sollte sie unvereinbar machen? Die Dokumentarfilme von Flaherty oder jene von Dziga Vertov. Was für eine Alternative! Auf Urlaub ans Meer oder in die Berge, nach Schottland oder an den Ohridsee in Makedonien – warum soll ich mich entscheiden müssen? Ich will alles. Muss ich Alfred Döblin abqualifizieren, weil ich die Krimis von Ross Thomas mag? Dürfen mir die Filme von Howard Hawks nicht gefallen, weil ich Tarkovskij bewundere? Muss ich Josef Hader meiden, wenn ich mir gerne ein Stück von Shakespeare ansehe? „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n“ – die höhere Wahrheit dieses Bekenntnisses scheitert allein an der Blonden oder der Braunen, je nachdem, die davon betroffen wäre und mir eine Entscheidung abverlangt.
Man will die Welt schön übersichtlich haben. Damit man sich in ihr orientieren kann. Deshalb wird sie uns sehr oft in Alternativen präsentiert. Aber die meisten Dinge treten nicht in so eindeutigen binären Formationen auf wie Tag und Nacht, heiß und kalt, schwarz und weiß, deren Elemente einander ausschließen.
Hoch- und Tiefkultur
In der Regel sind zwei oder mehr Möglichkeiten gleichzeitig und am gleichen Ort zulässig und sogar vereinbar. Nur eine sehr strenge protestantische Ethik verlangt einem ausgleichenden Verzicht ab, wo man sich einen Genuss gegönnt hat, eine Selbstbestrafung für jede Belohnung, der keine verdienstvolle Arbeit voranging.
Demgegenüber plädiere ich für Unbescheidenheit, nennen wir es meinetwegen Gier. Man sollte sich nichts versagen, was schön und angenehm scheint, wenn es sozial verträglich, also nicht nur auf Kosten oder gar zum Schaden anderer zu haben ist. Mehr noch: Man sollte auch allen Mitmenschen alles Schöne und Angenehme gönnen. Deshalb hat es nichts mit erzieherischem Eifer oder mit Bildungshochmut zu tun, wenn man, mehr oder weniger missionarisch, seine Umwelt von den Vergnügungen überzeugen möchte, denen man selbst so etwas wie Glück verdankt. Grundsätzlich, so die Überlegung, müsste doch jeder genießen können, woran man selbst Freude hat, wenn er dafür nur die nötigen Voraussetzungen und Bedingungen geboten bekommt.
Was die künstlerischen Alternativen betrifft, so versteckt sich, historisch gesehen, dahinter ein echter Gegensatz. Bis vor wenigen Jahrzehnten war, was man „Hochkultur“ nannte, dem gebildeten Bürgertum vorbehalten. Für das Gegenstück gibt es bezeichnenderweise keinen „eingebürgerten“ Begriff. Eine „Tief-“ oder „Niedrigkultur“ kennt unsere Sprache nicht. Die Hilfskonstruktionen lauten „Populärkultur“, „Trivialkultur“, „Trash“, und sie sind dem Proletariat zugeordnet. Vom Stolz einer klassenbewussten Arbeiterschaft, von dem noch das Wort „Arbeiterkultur“ kündete, war in den sechziger und siebziger Jahren wenig übriggeblieben. Mit den Chören und den Mandolinenorchestern, mit der Literatur der Arbeitswelt und den Konsumvereinen ist auch das Wort verschwunden.
Das Kreuz mit der Filmseite
Die Kulturkritik war (und ist) fest in den Händen der überwiegend bürgerlichen Medien, die ihrer Klientel gehorchend bis in die siebziger Jahre so gut wie ausschließlich über die Hochkultur berichteten. Die Populärkultur wurde ignoriert und, wenn doch einmal von ihr die Rede war, eher verachtet. Der Film, auch wenn er von Fellini oder Truffaut, von Kluge oder Angelopoulos gemacht war, wurde niemals als Kunst geschätzt wie Theater, Musik oder Malerei. Deshalb bleibt er bis heute in der Regel auf eine Sonderseite verbannt. Die hohe Kultur soll er nicht durch Nachbarschaft beschmutzen. Die Ausgrenzung aus dem Kulturteil im engeren Sinne hat zur Folge, dass beim Film – und nur beim Film – die Kritik an Kunstwerken sich schon frühzeitig mit der Kritik (wenn man es denn so nennen möchte) an Produkten einer Trivialkunst mischt, die eher wirtschaftlichen als ästhetischen Kriterien genügt.
Man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie der bekannte Wiener Kabarettist Gerhard Bronner in seiner regelmäßigen Radiosendung die Beatles verhöhnte, wie Friedrich Gulda von seinem Publikum beschimpft wurde, als er außer Beethoven auch Jazz spielte, welche Energien es kostete, bis Jazzgruppen und später Rockbands in Konzertsälen oder gar in Opernhäusern auftreten durften. Damals provozierte die Alternative Herbert von Karajan oder Elvis Presley tatsächlich noch eine Kampfansage. Wer sich für den hüftschwingenden Sänger aus Memphis aussprach, der selbst nach der Meinung von Frank Sinatra und erst recht im Urteil gestandener Bildungsbürger nicht singen konnte – dasselbe hatte man Jahre zuvor von Louis Armstrong behauptet –, entschied sich auch für dessen Fans, für die Jugendlichen, die „Halbstarken“, die Unterprivilegierten.
Inzwischen aber kosten die Eintrittskarten zu Rocksängern ebenso viel wie zu Konzerten der Wiener Philharmoniker, wenn nicht mehr, das Publikum unterscheidet sich kaum, es ist weder rufschädigend, in „besseren Kreisen“ U-Musik zu mögen, noch prestigefördernd, ältere oder gar zeitgenössische E-Musik zu lieben. Die Scheinalternative Rock versus „Klassik“ ist an keine Alternative der Klassenzugehörigkeit mehr zu knüpfen. Die Populärkultur hat für die Medien an Dignität gewonnen, sie widmen ihr Aufmacher, und eine neue CD von Bob Dylan oder Cat Stevens bekommt weitaus mehr Publizität als eine Uraufführung des Konzertstücks eines lebenden Komponisten. Auf der anderen Seite haben Institutionen wie das Klassik-Radio zu einer bemerkenswerten Popularisierung, um nicht zu sagen Trivialisierung der E-Musik beigetragen. Anna Netrebko oder Lang Lang werden als Popstars vermarktet, denen gegenüber ein Tom Waits fast schon wie ein früherer Repräsentant der Klassik erscheint. Wer sich also für Clapton und gegen Kremer entscheidet, bekundet lediglich, dass ihm der eine gefällt und der andere nicht. Für ein sozial definierbares Publikum spricht er längst nicht mehr.
Weder-Noch
Es gibt ein Gebiet, auf dem Alternativen selten sind: das Gebiet des Konsums. Da sich am Verkauf von Waren verdienen lässt, wird uns kein Geschäftsmann einreden wollen, dass wir uns entscheiden müssten, ob wir einen Mantel oder eine Hose anschaffen sollen, Handschuhe oder einen Schal, einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine, ein Auto oder einen Flug nach Mallorca. Aber es muss doch noch etwas mehr geben als das Glück des Einkaufens. Warum sollte man just dort, jenseits des Warenhauses der Logik des Entweder-Oder verfallen. Es existieren ja durchaus Fälle, wo das Weder-Noch angebracht ist. Vor die Wahl gestellt, zu prügeln oder sich prügeln zu lassen, wird man darin die beste Entscheidung erkennen.
Bei Kremer oder Clapton, Schottland oder Makedonien, der Cremeschnitte oder der Schaumrolle aber plädiere ich für das Sowohl-als-auch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!