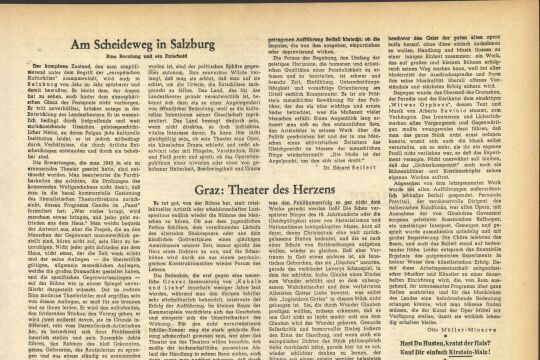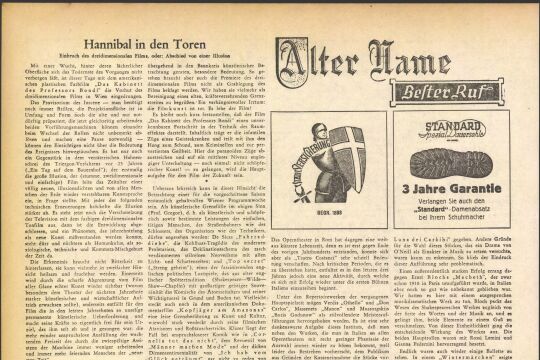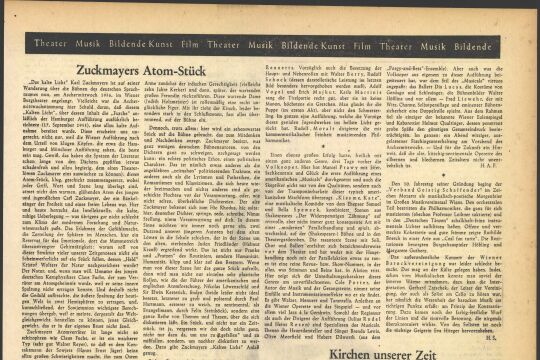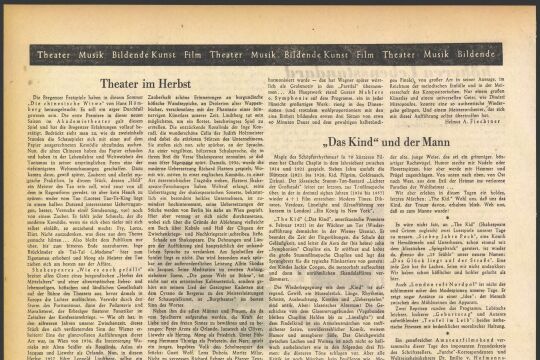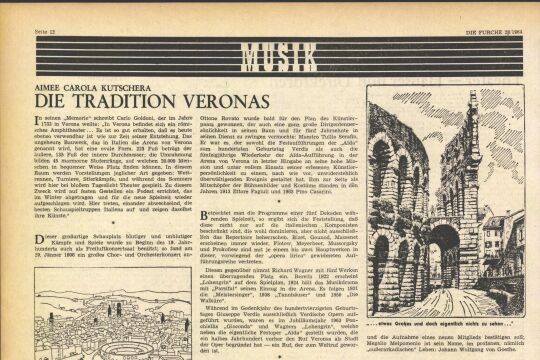Am 22. Dezember 1858 wurde Giacomo Puccini in Lucca geboren. Als er am 29. November 1924 stirbt, ist er der erfolgreichste Opernkomponist der Zeit, seinen Verächtern zum Trotz.
Die Verachtung war häufig ambivalent. Gustav Mahler schwankte zwischen Respekt und Aversion, was etwa seine Bezeichnung der "Tosca" als "Meistermachwerk" bezeugt. Anton Webern ließ sich ausgerechnet von der übel verrissenen "La fanciulla del West" so begeistern, dass er fassungslos an Schönberg von "ganz besonderen Klängen" schrieb - und er hat recht, denn der knallige Western von Räuber und Räuberbraut enthält prachtvolles Musiktheater, in dem die italienische Melodie und die Anno 1910 erregend neue Bitonalität ungeahnte Verbindungen mit einer gleichsam über den banalen Worten stehenden Wahrheit der Aussage eingehen. "Er hat Melodie, und die ist weder alt noch neu", das oft zitierte Urteil Verdis über den jungen Kollegen trifft die Substanz Puccinis. Ohne Melodie kann man nicht komponieren - diese Überzeugung musste etwa bei Luigi Nono Ablehnung hervorrufen. Wobei gerade Nono die Bedeutung Puccinis als des "eigentlichen Vaters der italienischen Moderne" anerkannte und nicht nur Webern, sondern auch andere auf den ersten Blick ferne Kollegen wie Janá\0x02C7cek oder Varèse aus ihrer Wertschätzung für Puccini kein Hehl machten.
"Tosca": wie im Zeitraffer
Das Phänomen Puccini füllt mittlerweile auch musikwissenschaftliche Bücher. Wer so hartnäckig Erfolg hat, wer mit gut zwanzig Stunden Musik zu den berühmtesten Komponisten der Geschichte gehört, muss mehr Vorzüge haben, als die eines geschickten Effektmusikers und Spezialisten für gefühlsseliges "melody service". Ein Vergleich mit Webern hinkt weniger, als man denkt. Auch dessen Werk füllt nicht mehr als einen langen Tag. Und - bei allem Unterschied in der Textur - Puccini findet gerade in der Kürze seiner Theaterszenen größte Wirkung und größte Modernität. Ein paar Takte genügen, um die Liebe zwischen Mimi und Rodolfo in "La Bohème" völlig glaubwürdig entstehen zu lassen. Wie im Zeitraffer rast der Thriller "Tosca" seinem letalen Ende zu, gepeitscht von harter, brutaler Klangsprache, die freilich an den dramaturgisch exakt richtigen Stellen Platz lässt für die großen Kantilenen, für die Inbrunst des Gefühls. Kaum je hat ein Komponist mit solch tiefer und doch mit nachtwandlerischer Sicherheit und maßhaltender Leidenschaft überschäumender Emotion Platz gegeben und den Aufschrei kreatürlicher Not so berührend gestaltet. Mimi stirbt eben nicht opernhaft, sondern ihr Atem erlischt mitten in der Phrase. Cavaradossis Sternenarie und Butterflys Warten auf das Schiff, die Verzweiflung der Nonne Angelica, die ihr Kind nicht sehen darf, die kindliche Liebe der gepeinigten Liu in "Turandot" sind nicht bloß tolle Theaterszenen, sie greifen tief in jene Abgründe des Menschlichen, die etwa zur selben Zeit Alban Bergs "Wozzeck" meint.
So flammend der Arbeiter Luigi in "Il tabarro" auch die Leiden des Proletariats besingt - Puccini war Sozialkritiker in seiner Kunst, nicht im Alltag. Der Spross einer seit 150 Jahren in der kleinen toskanischen Residenzstadt Lucca tätigen Familie von Stadtmusikern und Domorganisten wusste allerdings, was Armut bedeutet. Schon 1864 starb sein Vater, die tapfere Mutter musste sieben Kinder durchbringen. Als Kind war Giacomo Chorknabe und Organist, als 18-Jähriger beschloss er, sein Leben der Oper zu weihen, mit 22 gelang ihm die Aufnahme ans Mailänder Konservatorium. Die wilden Jahre der Bohème in der Aufbruchsstimmung des jungen Italien wollten so bald nicht enden. Alles, was der junge Komponist schrieb an Kirchenmusik, Liedern, Symphonischem und Kammermusik, mutet wie vorbereitende Studien zu seinen Opern an. Die Eigentümlichkeit, die von Schwermut durchflutete Schönheit der großen Puccini-Melodie ist von den ersten, tastenden Versuchen an da. Die Melodien der Jugend fließen in die Opern ein. Der Einakter "Le villi" war 1884 nicht mehr als ein Achtungserfolg, der textlich wirre "Edgar" von 1889 nicht einmal das. Der instinktsichere Verleger Giulio Ricordi glaubte trotzdem an den langsam sich entwickelnden Musiker. Erst 1893 gelang mit "Manon Lescaut" in Turin der Durchbruch, noch dazu in Konkurrenz zu Jules Massenets erfolgreicher "Manon". "La Bohème" eroberte ab 1896 die Bühnen der Welt.
Aus dem Bohèmien Puccini wurde der Gutsbesitzer in Torre del Lago bei Lucca, der Sportwagenfahrer mit der unvermeidlichen Zigarre im Mund und dem Jagdgewehr in der Hand, der ungetreue Familienvater und Frauenheld. Im Jahre 1900 folgte "Tosca" an der Scala di Milano, 1904 "Madama Butterfly", zunächst ein Skandal, weniger wegen der Kritik am Kolonialismus, mehr wegen der durch allzu viele schlechte, verkitschende Aufführungen in Misskredit geratenen Partitur, in der Pentatonik und unaufgelöste Dissonanzen, ja in der Urfassung sogar die fehlende Tenorarie das Publikum verstörten, so eingängig die Melodik auch sein mag. Skrupulös und minutiös arbeitete der stets mit seinen Librettisten hadernde Komponist an wenigen Opern. Mit der Genauigkeit von Filmdrehbüchern entstanden "La fanciulla del West" (New York, 1910) und "Il trittico" (Rom, 1919), in dem zwischen der Arbeitertragödie "Il tabarro" (Der Mantel) und der kostbaren, köstlichen Erbschleicherkomödie "Gianni Schicchi" die mystische Verklärung der "Suor Angelica" stattfindet. Daneben konnte das zunächst als Wiener Operette gedachte Schmerzenskind "La rondine" (Die Schwalbe) nicht wirklich reüssieren. Die leichtere Variante leiderfüllter Sinnlichkeit gelang dem wesensverwandten Freund Franz Lehár doch besser.
"Turandot": ein Wurf in die Moderne
Am Ende steht, postum uraufgeführt, "Turandot": nach so vielen Stücken über im Grunde einfache Menschen das mythische Heroendrama, musikalisch ein Wurf weit hinein in die Moderne. Der Kehlkopfkrebs hinderte Puccini an der Vollendung - vielleicht wäre er am Liebesduett der Mörderin Turandot und des Machos Kalaf ohnehin gescheitert. So bleibt der rührende Tod der kleinen Liu die letzte künstlerische Aussage eines Musikers, der in der Mehrzahl seiner Werke das Leiden der verlassenen, gequälten Frauen mit betörender Eindringlichkeit geschildert hat. Hatte Giacomo Puccini sein im Selbstmord endendes Dienstmädchen Doria wirklich am Gewissen?
Man darf weitere Fragen stellen. Wie hielt es der den Klerus scharf kritisierende Freigeist in Wahrheit mit der Religion? Die innige Beziehung zu seiner Schwester, die Äbtissin wurde, hielt er aufrecht. Wie diffus war seine Position dem Mussolini-Faschismus gegenüber? Betrachtet man die Puccini-Bilder, fällt hinter der Eleganz des Äußeren stets die ins Gesicht geschriebene Melancholie auf. Da mag ein wenig Pose sein, doch sie verdeckt bloß innere Einsamkeit. Puccinis Intensität des Empfindens wird bleiben, in der zeitlos gewordenen Wahrheit seiner Musik.
Der Autor lebt als freischaffender Dramaturg und Musikschriftsteller in Salzburg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!