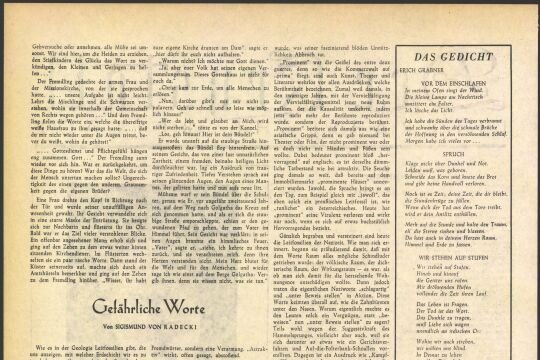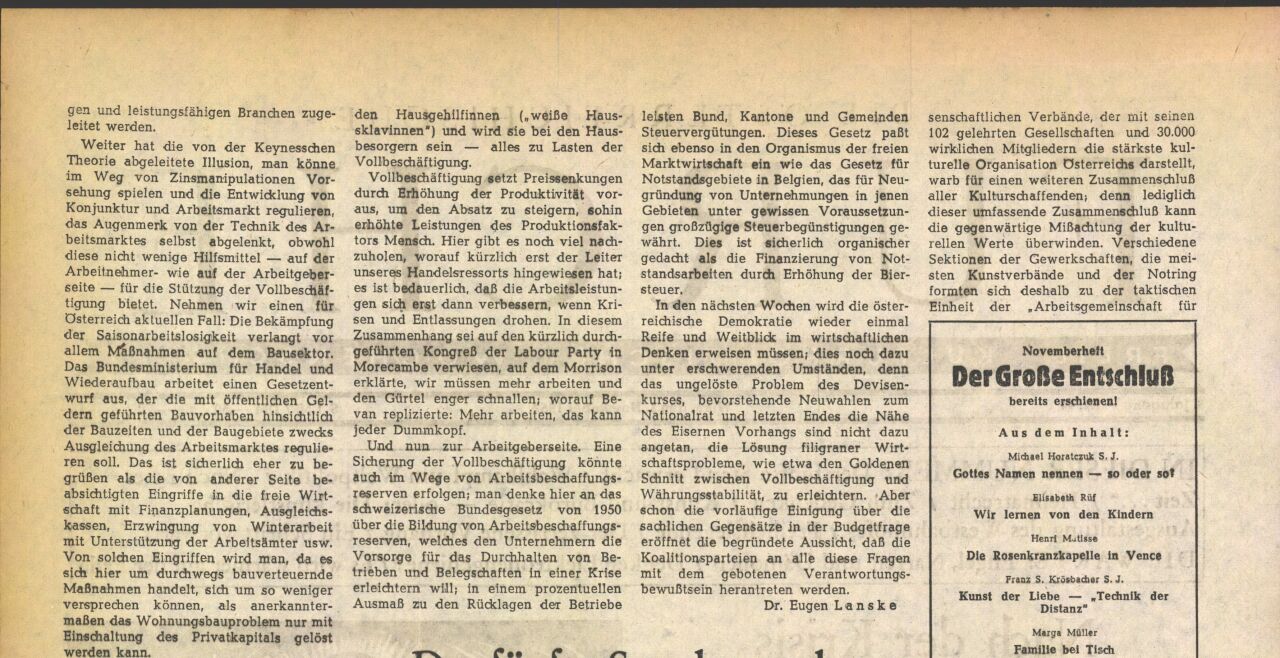
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
QUERSCHNITTE
Der Buchstabe h
Er gehört zu jenen Bestandteilen des Alphabets, die einen sanften Laut bedeuten, er stellt sozusagen nur einen Hauch, einen ganz zarten, dar. Er schmettert nicht, und er zischt nicht, wie es andere aus seiner Familie tun. Aber wenn er aus seinem schlichten, einfach-bürgerlichen Milieu in die bürokratische Zone oder gar in die gesetzgeberische Stilistik gerät, dann können mit ihm schreckliche Dinge vorgehen. In der NS-Gesetzgebung bedeutet er zum Beispiel für einen Autor das Verbot des Bücherschreibens und Bücher- druckens. Doch wir sind so weit, daß es dafür verschiedene Auslegungen, gewissermaßen verschiedene Stärken des H- Lautes gibt. Die mildeste, schon gar nicht mehr hörbare erlaubt zum Beispiel dem Skriptor Bruno Brehm, obzwar er seinen österreichischen Landsleuten stark auf die Nervein gegangen ist, Freiheiten, die der also Beschenkte nicht einmal zu würdigen weiß. Dafür gibt es andere Fälle, da sich mit dem Buchstaben h seltsame Geschichten verbinden. Da ist der Autor eines in der Hitlerzeit erschienenen Buches, an dem einzelne Stellen bei einer Neuauflage reparaturbedürftig sind, der Hauptinhalt jedoch eine sehr wertvolle Aussacm im Sinne österreichischer Geschichtsschreibung darstellt. Aber da ist der Buchstabe h, der das Buch in revidierter Auflage und überhaupt die literarische Betätigung des Autors unter Sperre legt. Doch kürzlich ist geschehen, was der Gerechtigkeit und der richtigen Einschätzung des Autors entsprang, der schon zur Hitlerzeit dem Nazismus tief enttäuscht den Rücken kehrte: der Bundespräsident hat dem Autor die literarische Freiheit zurückgegeben und seine Unterschrift unter den Gnadenakt gesetzt. Damit ist die Entscheidung durch die höchste staatliche Autorität gefallen. Das letzte Wort ist gesprochen und damit Punktum. Sollte man meinen. Aber noch lange nicht. Im Fall des Buchstabens h des Gesetzes vom 6. Februar 1947, RGBl. Nr. 25, ist noch die
Unterschrift des Bundeskanzlers nötig. Damit dieser amtshandeln kann, hat der Anschluß der Vorakten von seiten des Ministeriums des Innern zu geschehen, dann gehen alle Anlagen an das Bundeskanzleramt, und nach Herstellung einer den Aktenlauf verzeichnenden „Tabelle" darf der Bundeskanzler den Akt unterschreiben, den die oberste Instanz schon bejahend entschieden und unterschrieben hat. Und nun wandert der Akt noch zum Unterrichtsministerium, in dessen Vollzugsgewalt literarische Angelegenheiten gehören. Wenn alles gut gegangen ist, dann ist die fahrplanmäßige Odyssee zu Ende. — Da soll einer noch sagen, daß wir Österreicher uns das Leben zu leicht machen!
Aschenbrödelgeschichte
Kein Märchen. Aschenbrödel in moderner akademischer Ausgabe:
Ein Doktorat ausländischer Herkunft ist an der Wiener Universität zu „nostrifizieren", als gültig für Österreich anzuerkennen. Der Petent hat sich dafür einer Prüfung zu unterziehen. Das geschieht im Oktober 1952. Der Prüfling ist wohlbeschlagen; nach gut bestandenem einstüadigem Examen erhält er von dem zur Prüfung zuständigen Professor die Bestätigung der Nostrifikation. Für diese Prüfungen sind in allen Staaten der Welt Taxen zu entrichten; in Südamerika zum Beispiel sehr hohe Taxen. Der Professor der Wiener Universität spricht in der Universitätsquästur die Gebühr für die Prüfung und Anerkennung des ausländischen Doktortitels an: Auf Grund genauer amtlicher Berechnung erhält er dann, begleitet von schriftlicher Ausfertigung — 87 Groschen, in Buchstaben: Siebenundachtzig Groschen Der Professor hat für Hin- und Rückfahrt mit der Straßenbahn 2.60 S ausgegeben, somit hatte er nicht nur eine mit Defizit behaftete Amtshandlung hinter sich, sondern auch eine in Ziffern verdeutlichte Bestätigung der Aschenbrödelrolle der geistigen Arbeiter auf akademischem
Boden. Alles ist klar und unzweideutig. Unklar bleibt nur, wann der Prinz der Aschenbrödelgeschichte kommt. Es fehlt also das Happy-End, und das ist der große Schmerz.
Einer, der Schulden zahlt
Einer, der es mit der Kunst sehr ernst nimmt, der mit jeder Zeile und mit jedem Pinselstrich sein Bestes geben will, hat uns seine Theorie entwickelt. Er sagt:
„Die Kunst hat nie einen Anfang genommen, sie hat sich nie höher entwickelt. Die Bisons von Altamira, der Parthenongiebel, die Karlskirche, sie sind im Wesen alle gleich, höchstens im Handwerklichen, das ja bei jedem Kunstwerk mehr als drei Viertel ausmacht, verschieden. Genau so ist es beim Schreiben. Homer, Shakespeare, Goethe, kein Unterschied im wesentlichen. Die Menschen dürfen alle Kunst genießen, ohne irgendwelche Verpflichtungen zu haben. Wer aber selbst etwas schaffen kann, der hat bei Ovid, Palestrina, Dante, Mozart, Rembrandt, Beethoven Schulden. Sie haben ihm Freude gemacht, Freude im Sinne des Hymnus, also muß er trachten, auch Freude zu bereiten. Ich gehöre nur zu den Kleinen, zu den ganz Kleinen. Ich werde nie singen können: .Seid umschlungen Millionen!’ Aber zu Dreien oder Vieren kann ich vielleicht so sprechen. Und wenn ich ihnen die echte Freude bereite, sei es durch eine kleine Geschichte oder durch ein bescheidenes Aquarell, dann habe ich einen Teil meiner Schulden bezahlt. Und das muß ich fortsetzen, so lange ich kann. Dann darf ich mich einmal als letzter in die Reihe derer stellen, die als Sterne glänzen. Oder anders ausgedrückt: Ich habe mit meinem Pfunde gewuchert."
„Gute Geschäfte werden Sie aber auf diese Weise nie machen!" haben wir ihm entgegengehalten.
„Nein", hat er trotzig geschrien, „auf die kommt’s mir nicht an!“
„Gott sei Dank!" konnten wir beruhigt feststellen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!