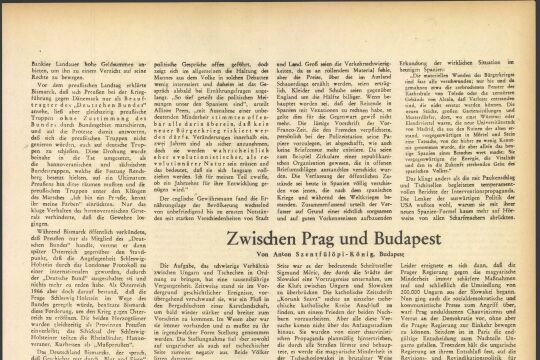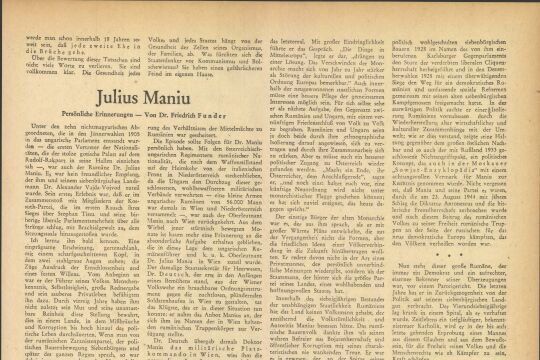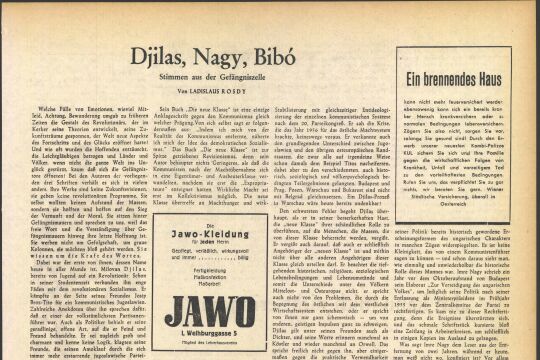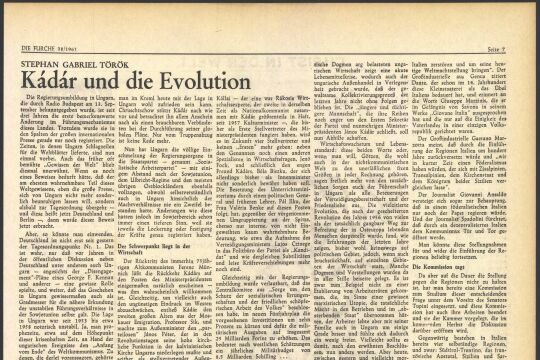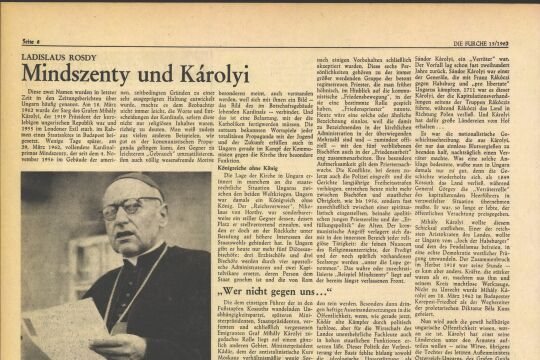Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ungleiche Nachbarn
„Diese Stadt ist wie ein Seismograph“, sagte mir ein ungarischer Funktionär in Budapest. „Weit entfernte Beben werden hier verzeichnet, als seien es lokale Erschütterungen.“ Kaum irgendwo löste Chruschtschows Sturz einen so starken Schock aus wie bei den Ungarn; der Schreck scheint ihnen noch heute ein wenig in den Gliedern zu sitzen, selbst den Jüngeren, die in den neun
Jahren seit dem Revolutionsjahr 1956 von Kindern zu Erwachsenen wurden ...
Die Empfindlichkeit der Ungarn wurzelt in dem Gefühl, mehr verlieren zu können als ein paar Freiheiten. Was in Bulgarien gerade hoffnungsvoll begonnen hat, in Rumänien fast nur noch auf die Außenpolitik beschränkt ist, in der Tschechoslowakei widerspruchsvoll gärt und in Polen seit langem auf halbem Wege verharrt — das ist von den ungarischen Kommunisten, nach ihren besonders bitteren Erfahrungen, zu einem stabilen — auch ideologisch abgestützten — System ausgebaut worden. Janos Käd&r wehrt sich, es mit „Liberalisierung“ abstempeln zu lassen, er nennt es „Humanisierung“, denn es besteht nicht so sehr aus Zugeständnissen, die man sich da und dort abrang, vielmehr aus einer bewußten Mischung von doktrinären und praktisch-vernünftigen Elementen. Das heißt zum Beispiel: vollständige Kollektivierung der Landwirtschaft und jedem Bauern ein Stück Land in eigener Verantwortung; Festhalten am Vorrang des „sozialistischen Realismus“ und Druck- und Spielerlaubnis für Sartre, Cocteau, Ionesco, Becke und Osborne; 60.000 Mann (fast unsichtbare) sowjetische Besatzung — und von Jahr zu Jahr sinkende eigene Militärausgaben; Minensperren an der Westgrenze — und Hunderttausende von Reisepässen für Westreisen, unverminderte atheistische Agitation — und „modus vivendi“ mit Kirche und Vatikan, vorbe-
haltlose Bindung an die sowjetische Außenpolitik — und selbständige Anknüpfung guter Kontakte zum Westen.
Ein gewisses Lächeln
All das geschieht ohne Spur von Verkrampfungen; in den Gesprächen, die der westliche Besucher in den Regierungskanzleien in Budapest, im Dorfgasthaus oder am Strand des
Plattensees führt, fehlt es nicht an Kritik, auch nicht an Sorgen, doch man spricht unbefangen, ohne Seitenblicke, zuweilen mit einem verschmitzten Lächeln, das seit k. u. k. Zeiten überdauert zu haben scheint. Dann aber gibt es Ereignisse, die plötzlich die verborgene Empfindlichkeit wie eine unverheilte Wunde freilegen — die Regierung weiß das und rechnet damit. Schon im vergangenen Jahr wollte zum Beispiel Kädär sein Amt als Regierungschef niederlegen, Chruschtschows Sturz ließ es ihm geraten erscheinen, zu warten. Die Parallelität hätte beunruhigt, obschon jederman weiß, daß Kädär als Parteiehef auch weiterhin die Zügel fest in den Händen hält. Nun ist die Regierung umgebaut worden* Kädär gab den Posten des Ministerpräsidenten ab — so wie er es schon einmal, 1958, getan hatte. Damals war Ferenc Münnich, der Mann der „harten Hand“, Ministerpräsident geworden, ein ehemaliger Sowjetoffizier, der nunmehr — 79jährig — in Pension gegangen ist. Kädär trat das Amt an Gyula, Kallai ab, seinen engsten Freund, mit dem er von den Stalinisten zwei Jahre lang in die Todeszelle gesperrt gewesen war. Als Kädär im November 1961 von Münnich die Ministerpräsidentschaft übernahm, sprach die Bekanntmachung des Zentralkomitees von der „Notwendigkeit, die Exekutivgewalt der Partei und der Staatsorgane zu stärken“, jetzt — kaum vier Jahre später — gab Kädär mit fast ähnlicher Begründung seinen Posten ab.
Was bringt Kallai?
„Die Stärkung der Führungsrolle der Partei erfordert eine bessere Verteilung der Leitungsarbeit.“ Das ist nur scheinbar ein Widerspruch, es ist vielmehr der Ausdruck einer ganz pragmatischen, den Zeitläufen angepaßten Taktik. 1961, unmittelbar nach dem 22. sowjetischen Parteitag, als der Konflikt mit China offen ausbrach und Chruschtschow das Ansehen Moskaus in Osteuropa durch die zweite Abrechnung mit Stalin befestigte — da mochte es in Ungarn ratsam sein, die Führungsfunktionen zu konzentrieren und einen Mann wie Münnich zur Seite zu drängen Heute, da die Autorität der neuen
Sowjetführung geschwächt ist (Kädär konnte sich vor kurzem bei einer Moskaureise davon überzeugen) und das Schlagwort von der „kollektiven Führung“ oftmals nur zentrifugale Bestrebungen verdeckt — da empfiehlt sich wieder die Teilung der Funktionen, zumal außer Bulgarien kein anderes Land im Osten die Personalunion von Partei- und Regierungschef kennt.
Dem Volk, das bei jedem Wechsel aufhorcht, werden beruhigende Zeichen gegeben. Außenminister Peter fuhr nach London. Kallai, der neue Premier, war kurz vorher als Leiter von Parteidelegationen nach Jugo-
slawien und Rumänien hervorgetreten; als der eigentliche Ideologe des Kädär-Kurses präsentierte er sich zwei Wochen vor seiner Ernennung in der Parteihochschule mit einer Vorlesung. Dabei rechnete Kallai noch einmal scharf mit dem Stalinismus der Räkosi-Periode und ihren Klassenkampfvorstellungen ab. Zugleich aber warnte er vor „rechten“ und „linken“ Mißverständnissen des gegenwärtigen Kurses der „nationalen Einheit“: diese hebe keineswegs die Unterschiede der Weltanschauungen und auch nicht die führende Rolle der Arbeiterklasse auf (wie es die „rechten“ Opponenten wünschen und die „linken“ befürchten).
Schiefer Blick auf Bukarest
Ihrem östlichen Nachbarn widmen die Ungarn ohnedies keine sonderlich herzlichen Gefühle; teils, weil die Rumänen ihre ungarische Minderheit nicht so fair behandeln wie seit einiger Zeit die Ungarn mit ihren Mino-
ritäten umgehen, teils, weil man in Budapest die außenpolitischen Eskapaden der Rumänen sorgenvoll betrachtet. Freilich ohne Neid. Denn die Gunst, deren sich Bukarest neuerdings im Westen erfreut, wächst — das wissen die Ungarn — auf einem schlüpfrigen Boden: antisowjetischen Tendenzen, die morgen schon wieder verschwinden können und in Rumänien mit einem wenig reformfreudigen innenpolitischen Klima verbunden sind. Die Ungarn, denen heute im Westen ebenfalls zunehmendes Wohlwollen begegnet, haben es — so scheint ihnen — solider erworben: bei standhafter Treue zu Moskau und spürbarem Ausbau der bürgerlichen Freiheiten im Inneren.
Freilich, die Unterschiede haben auch ihren handfesten wirtschaftlichen Hintergrund. Er tritt schon plastisch vor Augen, wenn man nach der Fahrt durch die unendliche agrarische Tiefebene Ungarns die Grenze bei Oradea überschreitet und gleich dem ersten rumänischen Industriekombinat begegnet — dem Anfang einer Kette von modernen, auch architektonisch eindrucksvollen Investitionen, die Rumäniens neues Gesicht prägen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!