Auch in Österreich gibt es Menschen, die trotz regelmäßiger Arbeit unter der Armutsgrenze leben. Rund 57.000 Personen zählen zu den "working poor".
Auf Not deutet nichts hin. Die junge Frau mit den blonden Haaren wirkt selbstbewusst und lebenslustig. Enge Jeans und eine modische Bluse betonen die zarte Figur. Die gebräunte Gesichtshaut lässt auf einen Winterurlaub schließen. Und doch ist das nur Fassade. Hilde Steindl aus Amstetten (Name und Ort geändert) gehört nicht zu den Gewinnern unserer Gesellschaft. Die Kleidung hat sie in einem billigen Ramschladen erstanden, und die sportlich-schicke Bräune stammt aus einem Solarium. Dort arbeitete Hilde Steindl im letzten Monat als Aufräumerin. Liegen wegräumen, aufwischen und Fenster putzen waren ihre Hauptaufgaben. Und wenn gerade nichts zu tun war, durfte sie sich selbst auch ein wenig bräunen lassen.
Kein Urlaub, kein Auto
Hilde Steindl ist arm, obwohl sie nicht auf der Straße lebt und sogar einen Job hat. Für die geringfügige Beschäftigung im Bräunungsstudio wird sie mit 180 Euro im Monat entlohnt. Außerdem bezieht sie eine Arbeitslosenunterstützung in Höhe von 600 Euro. Damit muss sie mit ihrem vierjährigen Sohn einen Monat lang auskommen. Und dann ist da noch jedes Monat eine Kreditrückzahlungsrate von 200 Euro zu entrichten. Was ihr danach noch an verfügbarem Einkommen bleibt, liegt kaum über dem Betrag, der als Armutsgrenze festgelegt ist. Sie ist ein Beispiel für "working poor". So werden Menschen bezeichnet, die trotz regelmäßiger Arbeit der Armut nicht entrinnen können.
Hilde Steindl hat gelernt, die damit verbundenen Einschränkungen zu ertragen. "Urlaub kenne ich nicht. Weggehen am Wochenende gibt es nicht", berichtet sie trocken. Das mache ich ihr eigentlich nicht viel aus. Auch das fehlende Auto sei zu verschmerzen. Anstrengend wird es nur, wenn der Arbeitsplatz früh am Morgen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist. Doch auch damit hat sie sich abgefunden: "Dann muss ich eben mit dem Rad hinfahren." Schwieriger wird es schon mit der Beaufsichtigung ihres Kindes. Der Kindergarten ist zwar gratis, doch für das Mittagessen muss ein Kostenbeitrag entrichtet werden. Dafür reicht das Einkommen aber nicht mehr. "Gott sei Dank zahlt das meine Mutter", freut sie sich über diese Unterstützung.
Mit so wenig Geld musste sie nicht immer auskommen. Zurück liegt eine Ehe, die nicht funktionierte, jahrelange Konflikte, schließlich die Trennung. Geblieben sind die Schulden. Aufgenommen für Möbel, Auto und viele Anschaffungen aus dem Versandhaus. Einen Teil der Schulden hat Hilde Steindl übernommen. Denn sie räumt ein, an den vielen Ausgaben nicht ganz unschuldig zu sein: "Ich konnte mit Geld nicht umgehen." Jetzt heißt es, das Versäumte mühsam nachholen.
"Working poor gibt es nicht nur in den USA, sondern leider auch bei uns", klagt Josef Kuttelwascher von der Caritas der Diözese St. Pölten. Der für das Waldviertel zuständige Sozialberater hat oft genug erlebt, "dass es sich bei vielen trotz einer Beschäftigung finanziell hinten und vorne nicht ausgeht." Die Ursache für die Not seien meist hohe Bankkredite oder durch den Hausbau entstandene Schulden. "Wer da einmal drinnen steckt, dem bleibt zum Leben nicht mehr viel übrig", weiß Kuttelwascher. Die Betroffenen seien meist unselbständig Erwerbstätige, in erster Linie Alleinerzieherinnen. Aber auch Landwirte und Selbständige seien von Verarmung betroffen. "Die versuchen aber ihre Not zu verschweigen, solange es nur irgendwie möglich ist." Er warnt aber vor Generalisierungen: "Jeder Fall ist anders gelagert. Verallgemeinerungen sind nicht sinnvoll."
Armut durch Kredite
Dass es sich hier um keine Einzelfälle handelt, dokumentiert eine kürzlich vom Sozialministerium herausgegebene Studie, die versucht, das Problem der "working poor" statistisch zu erfassen. "57.000 Personen gehören in Österreich trotz einer Berufstätigkeit zu den Armen", fasst Studienautorin Karin Heitzmann das Ergebnis zusammen. Als arm gelte, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens, also des mittleren Einkommens eines Landes (in Österreich 726 Euro) zur Verfügung habe und zusätzlich von wenigstens einem qualitativen Armutskriterium (beispielsweise Rückstände bei Zahlung von Miete oder Krediten, Substandardwohnung, große finanzielle Nöte beim Beheizen der Wohnung oder beim Beschaffen von Lebensmitteln) betroffen sei. Diese Kriterien seien bei der Quantifizierung des Armutsproblems üblich, so Heitzmann. Die Armut zu spüren bekommen aber nicht nur die Einkommensbezieher, sondern auch deren Familienmitglieder. "Rechnet man die ebenfalls dazu, dann kommt man in Österreich auf eine Zahl von mehr als 200.000 Menschen", erläutert Heitzmann. Betroffen von diesen Schwierigkeiten seien vor allem Alleinerzieherinnen, Mehrkindfamilien und Migrantenhaushalte. Aber auch bei Bauern und Selbständigen sei das Problem eines wachsenden Anteils von "working poor" nicht zu übersehen. Unlösbar sei das Problem aber keineswegs, meinen Experten. Zuversichtlich stimmt einmal die Tatsache, dass ein Teil der "working poor" nicht immer unter der Armutsgrenze bleibt. "Bei den Interviews für die Studie wurden dieselben Menschen über mehrere Jahre hinweg immer wieder befragt. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sich die finanzielle Situation bei vielen nach einem oder zwei Jahren wieder gebessert hat", berichtet Karin Heitzmann.
Treffsicherer Transfer
Trotzdem seien garantierte Sozialtransfers als Absicherung auf jeden Fall notwendig. "Transferzahlungen haben eine armutsvermeidende Wirkung und helfen den Betroffenen zielgerichtet", weist die Studienautorin das Argument mangelnder Treffsicherheit solcher Zahlungen zurück.
Der Autor ist freier Journalist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

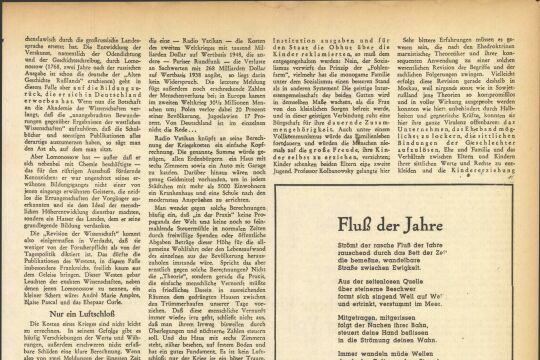

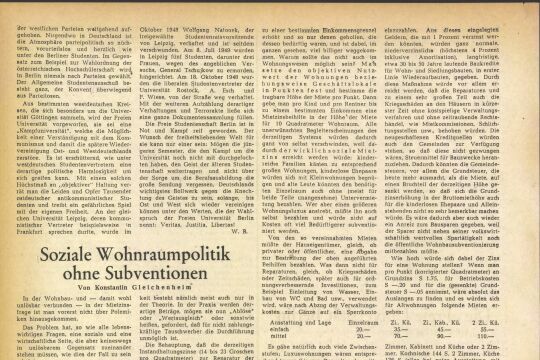




























































.png)






















