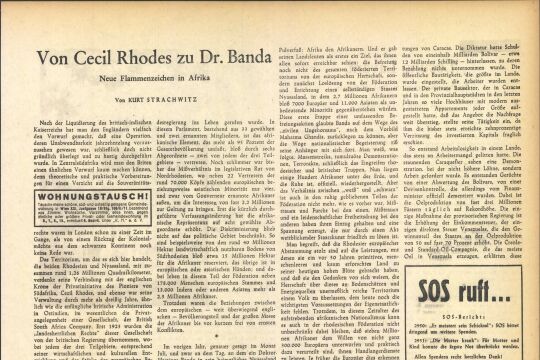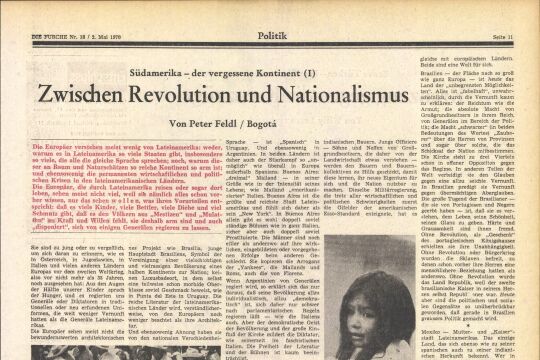Lateinamerikas Revolutionen: Ein Blick auf Erfolge und Rückschläge
Die bolivarische Revolution in Venezuela versprach Wohlstand und Gleichheit, kämpft aber nun mit wirtschaftlichen und politischen Krisen. Ein Überblick über die Entwicklungen in Lateinamerika.
Die bolivarische Revolution in Venezuela versprach Wohlstand und Gleichheit, kämpft aber nun mit wirtschaftlichen und politischen Krisen. Ein Überblick über die Entwicklungen in Lateinamerika.
Nach den Diktaturen, die fast ganz Lateinamerika im Griff hatten, folgten Jahre der Rückkehr zur Demokratie unter marktliberalen Vorzeichen.
Viele reformistische Regierungen vermieden strukturelle Reformen und nutzten die Einnahmen aus Rohstoffexporten, um Sozialprogramme zu finanzieren.
Fidel Castro
Als die Gefährten des Fidel Castro die Diktatur des ehemaligen Revolutionärs Batista vertrieben, waren sie noch keine Kommunisten. Erst die Sanktionen der USA trieben Kuba ins Lager Stalins.
Hugo Chávez
Der Revolutionär, der den Armen den Reichtum versprach, aber schließlich trotz des ungeheuren Ölreichtums von Venezuela in einer manifesten Wirtschaftskrise landete. Hugo Chávez.
Die Revolution hat in Lateinamerika derzeit keinen guten Ruf. Über die Bildschirme flimmern Aufnahmen von teilweise blutigen Demonstrationen in Caracas und von leeren Regalen in den Supermärkten Venezuelas. Die von Präsident Hugo Chávez (1999-2013) ausgerufene Bolivarische Revolution, die unbestritten Millionen Menschen Nahrung und Würde verschafft hat, scheint in den letzten Zügen zu liegen. Auch der Erfolg regierungstreuer Kandidaten in den jüngsten Regionalwahlen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der angestrebte Sozialismus des 21. Jahrhunderts weder die Aufhebung der Klassengegensätze, noch nachhaltigen Wohlstand für alle bringen konnte.
Nach den Diktaturen, die fast ganz Lateinamerika in den 1970er- und 1980er-Jahren im Griff hatten, folgten Jahre der Rückkehr zur Demokratie unter marktliberalen Vorzeichen. Der Internationale Währungsfonds diktierte die Bedingungen, unter denen die Haushalte saniert und die Exportwirtschaft neu ausgerichtet werden mussten. Man setzte auf Privatisierungen und die Ausbeutung von Rohstoffen. Die vorher empfohlenen Bemühungen, eigene Industrien aufzubauen, wurden verworfen, die Sozialsysteme ausgehungert. Soziale wie ökologische Folgen von Bergbauprojekten und industrieller Landwirtschaft blieben nicht aus. Menschen, die den Projekten im Wege standen, oft indigene Gruppen, wurden zwangsumgesiedelt oder vertrieben, Agrargifte verseuchten Böden und Gewässer und beschleunigten den Klimawandel. Unter den jungen Generationen machte sich Perspektivlosigkeit breit.
Frauen als treibende Kraft
Da die durch Privatisierungen geschwächten Gewerkschaften keine Schlagkraft mehr hatten und der bewaffnete Kampf nicht mehr als zielführend betrachtet wurde, traten neue soziale Akteure auf, allen voran Landlosenbewegungen, Indigene und Frauen. Sie waren die treibenden Kräfte, die die Massen politisierten und einen politischen Umschwung möglich machten.
Auf Venezuela folgten Argentinien, Uruguay, Brasilien, Bolivien, Ecuador, Paraguay. Mit Evo Morales erklomm erstmals ein Angehöriger der indigenen Mehrheit den Präsidentensessel in La Paz und wertete die prähispanischen Kulturen auf. In Chile regierte die Sozialdemokratin Michele Bachelet, die das Erbe der langen Pinochet-Diktatur aufzuarbeiten versprach, in Peru der Populist Ollanta Humala, der zumindest einen revolutionären Diskurs pflegte. Auch in Zentralamerika siegten Kandidaten links der Mitte. Auf dem Kontinent machte sich eine Aufbruchsstimmung breit, die durch eine günstige Entwicklung der Weltmarktpreise für Öl und andere mineralische Rohstoffe noch verstärkt wurde.
Tatsächlich trat der von Konservativen an die Wand gemalte Wirtschaftskollaps nicht ein. Im Gegenteil: Unter linken Präsidenten boomten die Wirtschaften und da die Einkünfte weniger einseitig verteilt wurden, konnten binnen weniger Jahre Millionen Menschen aus der Armut geholt werden. Selbst die Mittelschichten, die sahen, dass sie von ihrem Wohlstand nichts abgeben mussten, zeigten sich zufrieden.
Korruption und Untergang
Kurzen Prozess machten allerdings oligarchische Eliten mit Präsidenten, die ihre Interessen bedrohten. Fernando Lugo in Paraguay schob man 2012 einen Skandal in die Schuhe, um ihn dann in einem institutionellen Putsch abzusetzen. In Honduras gab man sich im Juni 2009 wenig Mühe, eine verfassungsmäßige Rechtfertigung für die Festnahme und Verbannung des linksliberalen Präsidenten José Manuel Zelaya zu erfinden.
Die meisten reformistischen Regierungen vermieden es daher, strukturelle Reformen anzugehen und nutzten die sprudelnden Einnahmen aus dem Rohstoffexport, um ihre Sozialprogramme zu finanzieren. Den privilegierten Schichten musste man damals nichts wegnehmen, um den Ärmsten zu helfen.
Lula da Silva musste sogar mangels eigener Mehrheit seiner Arbeiterpartei (PT) mit rechten Kräften paktieren, um einen Teil seiner Pläne verwirklichen zu können. Dieses Projekt, dass von seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff fortgesetzt wurde, "kippte massiv 2014 mit den hohen Ausgaben für die Fußballweltmeisterschaft und den Folgen der Finanzkrise".
In der politischen und kulturellen Krise hätten sich plötzlich alle provoziert und verängstigt gefühlt, sagt Ursula Prutsch, Professorin für Lateinamerikanistik an der Universität München: "Erstens protestierte die Oberschicht wegen des Verlustes exklusiver Räume und erhöhter Mindestlöhne, die sie für ihre Hausangestellten zahlen mussten; zweitens fühlen sich die Unterschichten, die berechtigte Angst haben, materielle Vorteile zu verlieren, um Aufstiegschancen geprellt".
Protest und Perspektiven
Protestmärsche der ehemaligen PT-Basis wurden von den bürgerlichen Kräften gekapert und in eine Bewegung zur Absetzung der Präsidentin verwandelt. Ausgerechnet die korruptesten Abgeordneten betrieben ein letztlich erfolgreiches Impeachment wegen der vergleichsweise lässlichen Verfehlung des Schönens von Budgetzahlen vor Wahlen.
In Ecuador und Bolivien, wo die Einnahmen aus Erdöl und Erdgas gewaltige Sozialreformen ermöglicht hatten, begann mit dem Einbruch der Rohstoffpreise die Krise. "Die progressiven Regierungen waren nicht imstande, vom Extraktivismus wegzukommen", kritisiert René Kuppe, Professor am Juridicum in Wien.
Vor allem die indigenen Völker, die von Bergbauprojekten besonders betroffen sind, seien enttäuscht worden. Ihr Vertrauen in den Staat sei dadurch erschüttert worden. In Bolivien verlor Präsident Evo Morales vergangenes Jahr ein Referendum, das ihm eine dritte Amtszeit ermöglichen sollte. In Ecuador konnte die Regierungspartei im vergangenen Juni ihren Kandidaten Lenín Moreno nur mit knapper Mehrheit durchbringen. Korruption, auch wenn sie in geringerem Ausmaß stattfindet, wird den Linken weniger verziehen als den traditionellen Parteien. Und gegen die in vielen Ländern ausufernde Gewalt hält die Wählerschaft die Eiserne-Faust-Rezepte der Rechten für zielführender als langfristig wirkende Sozialmaßnahmen.
Der Aufwind der Konservativen ist unübersehbar. So hat Präsident Mauricio Macri, der in Argentinien ein straff neoliberales Programm durchzieht, durch die jüngsten Kommunalwahlen eine überraschende Bestätigung erfahren. In Brasilien verlor die PT vor einem Jahr 400 ihrer 600 Bürgermeister. Noch schlimmer sei die derzeitige Planlosigkeit der Linken, so Martin Coy, Brasilienspezialist an der Uni Innsbruck: "Momentan hat die PT gar keine Projekte. Es herrscht eine Art apokalyptische Stimmung: alles geht den Bach runter." Was ihm aber Hoffnung gibt, sind "unendlich viele spannende Ansätze in der Regionalpolitik".
Eine nachhaltige Pendelbewegung nach rechts wollen Experten also nicht sehen. Der argentinische Ökonom Andrés Musacchio ist überzeugt, dass es in Argentinien demnächst wieder zu einem politischen Umschwung kommen werde. Nicht weil Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, die gerade einen Sitz im Senat erobert hat, so überzeugen würde, sondern weil Präsident Macris Politik ausschließlich den Reichen diene: "Die finden mit jährlich 30 %Rendite im Finanzsektor spektakuläre Bedingungen vor." Allerdings würden die Gewinne nicht reinvestiert: "Sie nützen diese Bedingungen, solange es sie gibt, und schaffen das Kapital ins Ausland." Sozialprogramme würden gekürzt. "Da steckt ein überschießender Klassenhass dahinter. Ein Programm, das Kinder in öffentlichen Schulen mit Laptops ausstattete, war gar nicht teuer. Trotzdem wurde es eingestellt."
Auch der Politikprofessor Ulrich Brand von der Uni Wien hält es für verfrüht, von einem Ende des progressiven Zyklus zu sprechen. Schließlich habe sich das Linksbündnis Frente Amplio in Uruguay konsolidiert und in Bolivien gebe es derzeit keine politische Alternative. Gert Eisenbürger schließt sich in der deutschen Lateinamerika-Fachzeitschrift "ila-Info" dieser Meinung an, "zumal die Rechte derzeit außer der Verteidigung der Privilegien ihrer Klientel wenig politisch zu bieten hat".
Dieser Artikel ist im Original unter dem Titel "Die Revolution in der Sackgasse" am 9. November 2017 erschienen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!