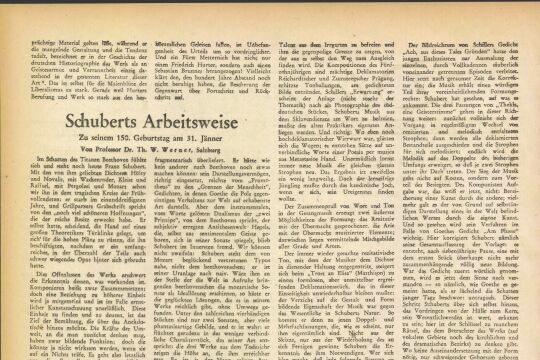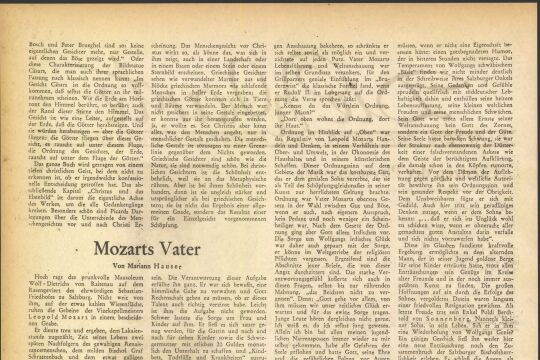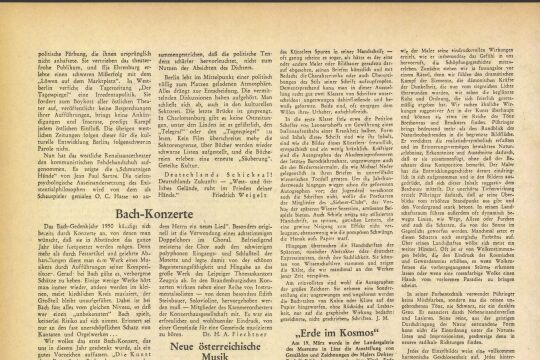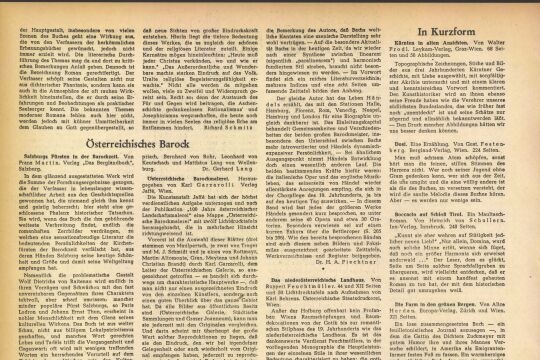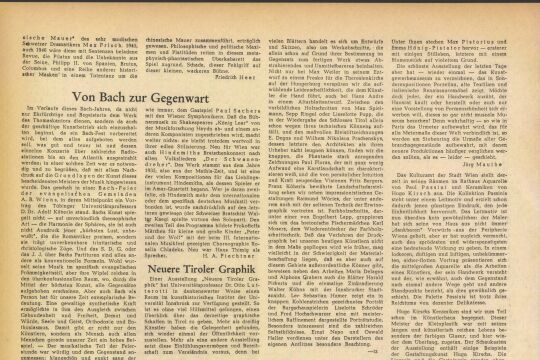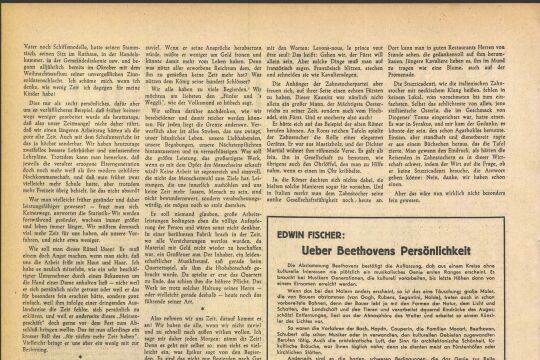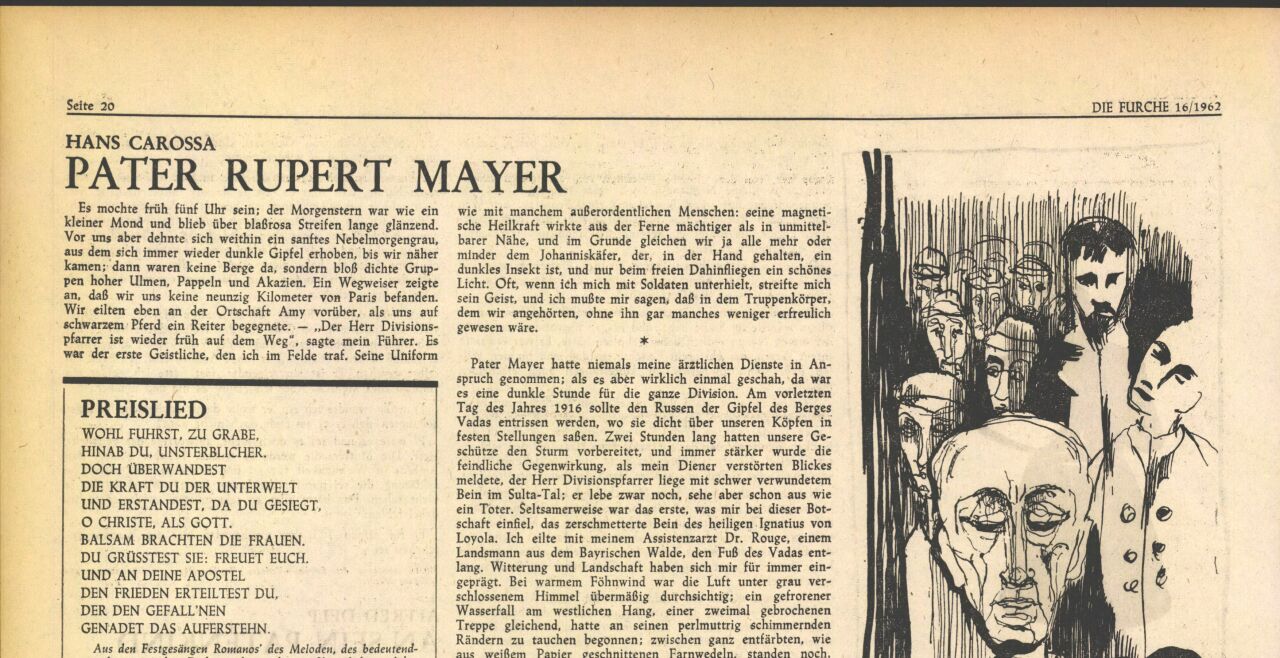
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
BACH UND DIE MODE
Wieder strömen allerorts Zehntausende in diesen Passions-und Ostertagen 1962 in die ausverkauften Konzerte mit Werken Johann Sebastian Bachs. Wissen diese „Bach-Verehrer“ noch, daß Mizler in seiner „Musikalischen Bibliothek“ über die Llr-aufführung der „Matthäuspassion“, am Karfreitag 1729 in Leipzig, nichts weiter zu berichten wußte als von einer „unvergleichlichen Passionsmusik, welche wegen der allzu heftigen in ihr ausgedrückten Affekte in der Kammer eine gute, in der Kirche aber eine widrige Wirkung gehabt habe“. Auch Kurfürst Friedrich August III. erkannte das Genie seiner Zeit nicht, sondern lebte an ihm vorbei, obwohl er ihm nach Jahren der völligen Teilnahmslosigkeit, 1736, auf nochmaliges Ansuchen hin, „um seiner guten Geschicklichkeit willen“, das Prädikat als Kompositeur bei der Hofkapelle verlieh.
Bach stand am Ende einer gewaltigen Stilepoche. Alles, was von Palestrinas römischer, Gabrielis venezianischer, Vittorias spanischer und Orlando di Lassos niederländischer Schule auf ihn einwirkte, festigte sich an ihm, vertiefte sich in ihm und kam als-eine überwältigende Synthese zum Ausbruch. Er schuf Kirchenkantaten von noch nie dagewesener Vollkommenheit, schrieb Passionen, die weit über jene des Altmeisters Heinrich Schütz hinauswuchsen und schenkte uns in der „Hohen Messe“ ein christlich-abendländisches Gemeingut, über Konfessionen hinweg, Tradition und Reformen verbindend. Was — so könnte man formulieren — ein Dreißigjähriger Krieg im Herzen Deutschlands Wunden riß, das heilte dieser Mann mit einem gottgeweihten Werk, geboren aus kraftvoller, aufrichtiger Gläubigkeit und natürlicher Lebensbejahung.
Kennen die ungezählten Besucher sämtlicher Veranstaltungen mit Werken Johann Sebastian Bachs den ungeschminkten, unpathetischen Ablauf des Lebens dieses Einmaligen? Haben sie noch ein Gespür für die wahre Größe in der Einfachheit, für die wahre Einfalt des Berufenen, für die Naivität eines schöpferischen Prozesses? Liegt hier nicht ein Widerspruch vor, eine arge Diskrepanz zwischen Entstehung und Entgegennahme? Dabei sieht man auffallend viele iunge Menschen unter den Zuhörern. Das wäre von Herzen zu begrüßen, hätten sich da nicht einige, sehr wesentliche Fehlurteile eingeschlichen. Beispielsweise soll die Musik Bachs dem Jazz nahestehen, und so «h d, was ein „gebildeter Jazzexpertc“ sein will, er den „alten Bach“ auch immer und überall gelten lassen. Aber erstens ist der Jazz schon lange nicht mehr das, was er sein sollte: eine spirituelle, kultische Musik von elementarer Kraft und ekstatischer Vitalität, sondern nur noch süßfarbener Abklatsch schwarzer Mysterien und getarnte zivilisatorische Dekadenz. Zum anderen kommt die vielzitierte Kunst der Improvisation bei Bach aus einem einzigen Jubilate, aus einem endlosen „Gloria in excelsio Deo“, beim Jazz aber von einer äußerlich aufgesetzten Freude am Instrument, an der Beherrschung technischer Kniffligkeiten und harmonischer Avantgardistereien. Eine zweite Fehlspekulation ist die von dem „modernen Bach“. Da sitzen die gleichen Jünglinge und Mädchen in einem Konzert mit elektronischer Musik oder „musique concrete“, die auch bei einem Bach-Abend anzutreffen sind. Ja glaubt man denn wirklich und wahrhaftig, daß Johann Sebastian Bach, der Schöpfer eigener akustischer Gesetze und fromme Beter, ein Komponist von jener sagenhaften Objektivität gewesen sei, die man heute den Repräsentanten der Moderne — ohne deren Wollen und Verschulden — unterschiebt?
Unsere „Bach-Mode“ bedarf einer Regenerierung von innen her. Gerade weil der Thomaskantor nicht für die Ewigkeit, sondern für seine Mitmenschen schaffen wollte — für seinen sonntäglichen Gottesdienst und das mäßige Geistesleben seines Hofes —, lebt er für alle Zeiten. Keine Träumereien können das Profil dieses Einzigartigen verwischen, nein, was wir in dem Leipziger Meister finden, ist die Erfüllung der Sehnsucht nach einem inneren, unbeirrbaren Gesetz, nach einer allumfassenden, geistigen Schau. Nur aus diesem Empfinden heraus können wir die „Kunst der Fuge“ begreifen, in deren letztem Satz — einer vierstimmigen Quadrupelfuge — die Handschrift des Meisters abbricht, nachdem die Tonfolge b, a, c, h den Namenszug Bach ergeben hatte. Es sei den recht unterschiedlichen Enthusiasten ins Gewissen geredet, daß dieser Bach, schon erblindet, vom Sterbebett aus dem Schwiegersohn Altnikol den letzten, wunderbaren Orgelchoral diktierte: „Vor deinen Thron tret' ich hiermit.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!