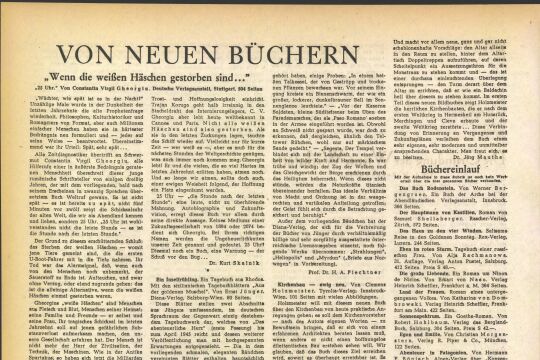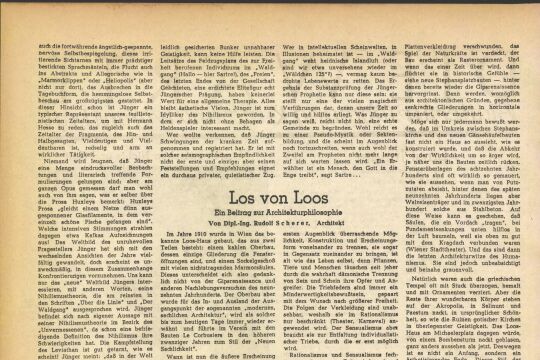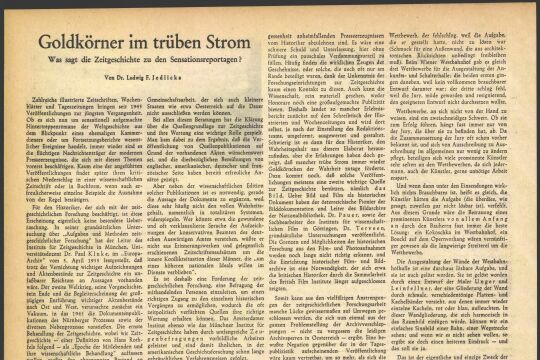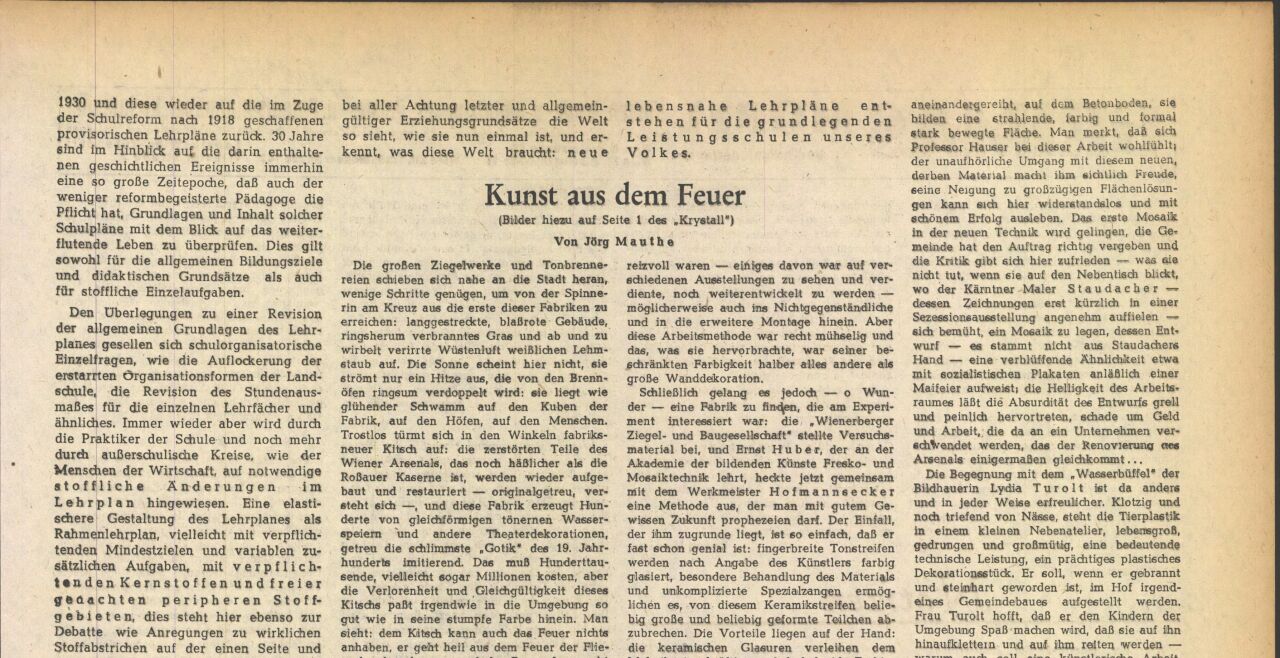
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kunst aus dem Feuer
Die großen Ziegelwerke und Tonbrennereien schieben sich nahe an die Stadt heran, wenige Schritte genügen, um von der Spinnerin am Kreuz aus die erste dieser Fabriken zu erreichen: langgestreckte, blaßrote Gebäude, ringsherum verbranntes Gras und ab und zu wirbelt verirrte Wüstenluft weißlichen Lehmstaub auf. Die Sonne scheint hier nicht, sie strömt nur ein Hitze aus, die von den Brennöfen ringsum verdoppelt wird: eie liegt wie glühender Schwamm auf den Kuben der Fabrik, auf den Höfen, auf den Menschen. Trostlos türmt sich in den Winkeln fabriksneuer Kitsch auf: die zerstörten Teile des Wiener Arsenals, das noch häßlicher als die Roßauer Kaserne ist, werden wieder aufgebaut und restauriert — originalgetreu, versteht sich —, und diese Fabrik erzeugt Hunderte von gleichförmigen tönernen Wasserspeiern und andere Theaterdekorationen, getreu die schlimmste „Gotik des 19. Jahrhunderts imitierend. Das muß Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen kosten, aber die Verlorenheit und Gleichgültigkeit dieses Kitschs paßt irgendwie in die Umgebung 60 gut wie in seine stumpfe Farbe hinein. Man sieht: dem Kitsch kann auch das Feuer nichts anhaben, er geht heil aus dem Feuer der Fliegerbomben hervor, und der Brennofen macht ihn nun wetterfest. Er bleibt zurück und übrig. (Die Arbeiter haben freilich Vergnügen an den neu-neogotischen Wasserspeiern und den Rittern auf ihren tömernen Füßen: aber ihre Freude rechtfertigt nicht den sinnlosen Auftrag.)
Im ersten Stock des Hauptgebäudes aber ist ein langgestreckter, weißer Saal, in dem sich die brütende Hitze zu schmerzhafter Helligkeit wandelt: auch hier tauchen zwar noch sekundenlang die unseligen Wasserspeierköpfe auf, von Arbeiterinnen auf kleinen Rollwägelchen von einer Formerei zu einem Ofen und wieder zurück geschoben; sie passieren den Raum nur. Denn hier hat das Feuer bessere Arbeit zu leisten.
Seit Jahren bemühen sich einige findige Köpfe um eine neue, finanziell tragbare und künstlerisch akzeptable Mosaiktechnik, denn die seit Jahrhunderten und länger übliche Glassteintechnik ist teuer, sehr teuer. Unternehmungslustige Kunstakademiker versuchten sich zunächst an einer Art von Natursteinmosaik, sie sammelten Kiesel und bunte Steine, Ziegelbrocken und allerhand anderes Steinsplitterzeug, und fügten es zu Bildern zusammen; so entstanden Dinge, die gewiß reizvoll waren — einiges davon war auf verschiedenen Ausstellungen zu sehen und verdiente, noch weiterentwickelt zu werden — möglicherweise auch ins Nichtgegenständliche und in die erweitere Montage hinein. Aber diese Arbeitsmethode war recht mühselig und das, was sie hervorbrachte, war seiner beschränkten Farbigkeit halber alles andere als große Wanddekoration.
Schließlich gelang es jedoch — o Wunder — eine Fabrik zu finden, die am Experiment interessiert war: die „Wienerberger Ziegel- und Baugesellschaft stellte Versuchsmaterial bei, und Ernst Huber, der an der Akademie der bildenden Künste Fresko- und Mosaiktechnik lehrt, heckte jetzt gemeinsam mit dem Werkmeister Hofmannsecker eine Methode aus, der man mit gutem Gewissen Zukunft prophezeien darf. Der Einfall, der ihm zugrunde liegt, ist so einfach, daß er fast schon genial ist: fingerbreite Tonstreifen werden nach Angabe des Künstlers farbig glasiert, besondere Behandlung des Materials und unkomplizierte Speziialzangen ermöglichen es, von diesem Keramikstreifen beliebig große und beliebig geformte Teilchen abzubrechen. Die Vorteile liegen auf der Hand: die keramischen Glasuren verleihen dem Mokaik eiine kräftige und doch luzide Farbigkeit, das Mosaik ist wetterfest und unbegrenzt dauerhaft, seine Behandlung schließlich denkbar einfach. Das Kulturamt der Stadt Wien beweist in Angelegenheiten der bildenden Kunst nicht immer eine glückliche Hand; aber dadurch, daß es dieses Unternehmen stützt, macht es manche Fehler wieder gut. Und der erste Auftrag, welcher der künstlerischen Ausgestaltung eines Neubaus mit einem der neuen Mosaike galt, wurde mit Taktgefühl vergeben.
An einem langen Tisch steht Professor Carry Hauser und fügt Sternchen um Steinchen zusammen. Unter seinen Händen entsteht ein sehr umfangredches Mosaik, acht Meter hoch, drei Meter breit; sein Thema: die vier Lebensalter. Trotz der vereinfachten Technik verschlingt ein solches Unternehmen sehr viel Zeit: Professor Hauser wird, alles in allem, mehr als ein Jahr gearbeitet haben, wenn das Werk beendet ist. Er hat das Mosaik in etwa dreißig Zentimeter breite quadratische Täfelchen geteilt; jede dieser Tafeln wird eret mit Stahldraht armiert, mit Zement ausgegossen und an ihre Nachbarin gefügt. Etwa die Hälfte des Mosaiks ist bereits vollendet, seine Täfelchen liegen, lose aneinandergereiht, auf dem Betonboden, sie bilden eine strahlende, farbig und formai stark bewegte. Fläche. Man merkt, daß sich Professor Hauser bei dieser Arbeit wohliühlt; der unaufhörliche Umgang mit diesem neuen, derben Material macht ihm sichtlich Freude, seine Neigung zu großzügigen Flächenlösungen kann eich hier widerstandslos und mit schönem Erfolg ausleben. Das erste Mosaik in der neuen Technik wird gelingen, die Gemeinde hat den Auftrag richtig vergeben und die Kritik gibt sich hier zufrieden was sie nicht tut, wenn sie auf den Nebentisch blickt, wo der Kärntner Maler Staudacher dessen Zeichnungen erst kürzlich in einer Sezessionsausstellung angenehm auffielen — sich bemüht, ein Mosaik zu legen, dessen Entwurf — es stammt nicht aus Staudachers Hand — eine verblüffende Ähnlichkeit etwa mit sozialistischen Plakaten anläßlich einer Maifeier aufweist; die Helligkeit des Arbeitsraumes läßt die Absurdität des Entwurfs grell und peinlich hervortreten, schade um Geld und Arbeit, die da an ein Unternehmen ver- schVendet werden, das der Renovierung eres Arsenals einigermaßen gleachkommt…
Die Begegnung mit dem „Wasserbüffel“ der Bildhauerin Lydia T u r o 11 ist da anders und in jeder Weise erfreulicher. Klotzig und noch triefend von Nässe, steht die Tierplastik in einem kleinen Nebenatelier, lebensgroß, gedrungen und großmütig, eine bedeutende technische Leistung, ein prächtiges plastisches Dekorationsstück. Er soll, wenn er gebrannt und steinhart geworden ist, im Hof irgendeines Gemeindebaues aufgestellt werden. Frau Turolt hofft, daß er den Kindern der Umgebung Spaß machen wird, daß sie auf ihn hinaufklettein und auf ihm. reiten werden — warum auch soll eine künstlerische Arbeit, sagt sie, nicht Kindern wie ein hübsches Spiel- zeug erscheinen.
Wieder zurück über den großen Fabrikhof. Die Zahl der gräßlichen Wasserspeier ist unterdessen größer geworden. Nun ja, der Kitsch hat’s leichter: er wird ja nicht gearbeitet, nur produziert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!