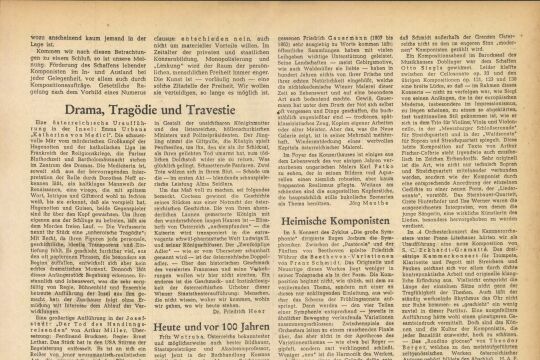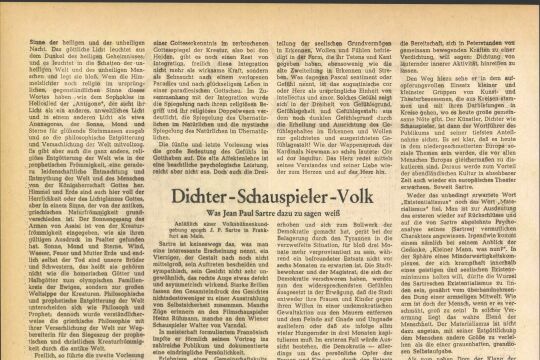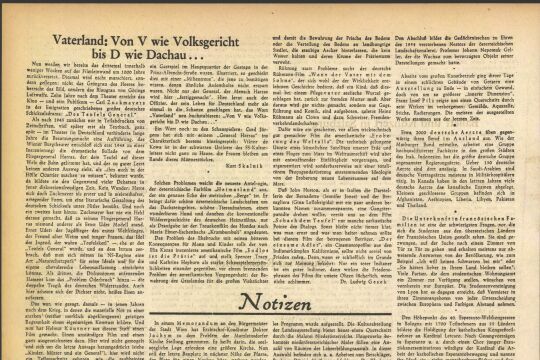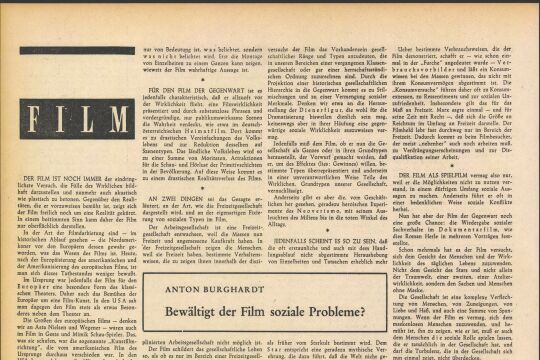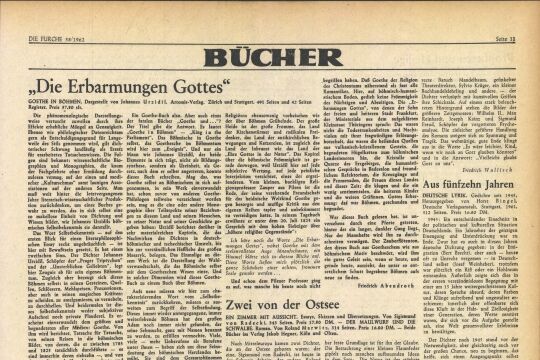Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Alltag als Welttheater
Thornton Wilder ist so etwas wie ein „Poeta doctus“. Dieser immens gebildete, dem europäischen Geist so nahe amerikanische Dichter kann ebenso gelehrt und fesselnd ein Kolleg über Größe und Zerfall des Theaters halten wie als Dramatiker verblüffend bedenkenlos allen gelehrten Plunder beiseiteschieben, um in dem Schauspiel „Unsere kleine Stadt“ (Our town), in einem Mosaik von Alltäglichkeiten einer amerikanischen Kleinstadt um 1900, das Schicksal der Familien Gibbs und Webb stellvertretend für das Lebensdrama der Menschheit zu jeder Zeit, in jedem Jahrhundert zu gestalten. In seinem Beitrag im Programmheft „Um die Befreiung der Phantasie“ plädiert Wilder für eine „Bühne der inneren Vorstellung“, die eine besonders intensive Mitarbeit des Publikums verlangt. Gleichzeitig zitiert er aus einem Gespräch mit Sigmund Freud den Satz, daß sich die Dichter, nachdem die Wissenschaft die ihnen allein gehörende Sphäre „erhellt und jedem Normalbegabten zugänglich“ gemacht habe, „sich in neuen Dunkelheiten verlieren“ sollten. Indem Wilder jedem einzelnen in der winzigen Stadt, die Grovers Comer's heißt, ins Herz sieht, sehen wir sie alle ganz nahe — und gleichzeitig ganz fern, als lebten sie auf einem andern Stern. Jeden Augenblick gelingt es Wilder in den drei Akten, die zum Sinnbild von Wachsen, Leben und Sterben werden, ein Gefühl von großer Nähe und großer Distanz zu den Menschen und ihren Angelegenheiten herzustellen. Das Alltägliohe geht ins Außerordentliche, das Besondere ins Allgemeine über.
Es ist ein Stück ohne „Handlung“, ohne „Konflikte“, nichts als kleinste Ereignisse des täglichen Lebens, durchzogen von puritanischer Fröhlichkeit und einigen Sehnsüchten der Jungen und noch nicht Alten, auf einen universalen Prospekt hin angeordnet. Und dennoch ist es nicht undramatisch, mag auch die Güte des Menschlichen von märchenhafter Unglaubwürdigkeit, der einzige Ausbund des Bösen darin ein ewig betrunkener Organist sein. „Du mußt das Leben lieben, um wirklich zu leben, und du mußt wirklich leben, um das Leben zu lieben.“ Die fast leergelassene Szene strömt so viel Wärme aus, weil Thornton Wilder den Menschen liebt. Darum gelingt es ihm, so unfaßbare Dinge wie das menschliche Leben in schlichte Weisheit umzusetzen.
Die Aufführung im Theater in der Josef Stadt war von Hans Jaray mit sichtlichem Vergnügen und viel Einfühlungsvermögen eingerichtet; er gibt auch den Spielansager und Kommentator. Der Akzent der Regie liegt deutlich beim „bühnenwirksamen“ zweiten Akt. Erfreulich gut besetzt ist das junge Paar: Marianne Nentwich, frisch und liebenswert in ihrer verzweifelten Lebens-sehnsuoht als Emily, Matthias Fuchs, der als George Gibbs einen schönen Übergang vom Burschenhaften zum Männlichen findet. In den Rollen der Erwachsenen beeindrucken Vilma Degischer und Ursula Schult als Mütter. Fritz Schmiedel und Guido Wieland spielen die Väter. Ein Kabinettstück diskreter Komik liefert wieder einmal Leopold Rudolf in der Rolle eines zerfahrenen, kauzigen Professors. Das einzige Spielelement, das nicht ganz gelang, war das Pantomimisohe. Es gab lebhaften Beifall für Darsteller und Stück.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!