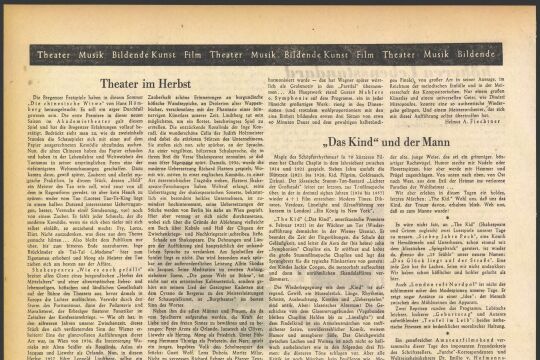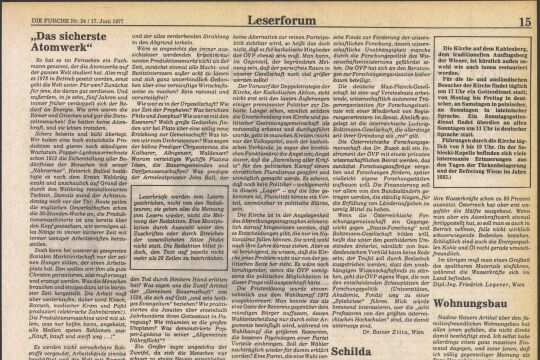Autobiographien haben, so unzuverlässig sie im einzelnen sein mögen, einen unersetzlichen zweifachen Wert. Sie reißen blitzartig Hintergründe aus dem Dunkel des schöpferischen Aktes auf und gewähren Einblick in die Zeit und Umwelt des Künstlers, so intuitiv und hellsehend, wie niemand sie sieht, auch nicht der Historiker. Handelt es sich noch dazu um den Universalkönner (Buchautor, Regisseur, Darsteller, oft auch Kameramann und Musiker) Charles Chaplin, den Bernard Shaw das einzige Genie der Filmgeschichte genannt hat, durfte man auf die Selbstdarstellung seines Lebens und Werkes (Charles Chaplin: Die Geschichte meines Lebens, S.-Fischer-Verlag 1964, 515 Seiten, 110 Illustrationen, Preis 207.20 Schilling) um so gespannter sein, trotz der maßlos herumirrenden Chaplin-Literatur, von der der Verfasser dieser Zeilen allein acht deutsch geschriebene oder ins Deutsche übersetzte Bücher besitzt, darunter das bedeutende des Franzosen Sadoul und die berühmt gewordenen Indiskretionen eines der zehn Kinder Chaplins, Charles junior.
Chaplins Kindheit und Jugend ist eine Dickens-Geschichte. Charles Spencer Chaplin wurde 1889 in London geboren, wie Friedrich Luft sagt: „...dem gleichen Jahre, in dem Thomas A. Edison in Amerika die Erfindung des .Kinetoskop' perfektionierte. Vom Vater, einer kleinen Berühmtheit unter den minderen Chansonniers im London jener Jahre, hat er französisch-jüdisches Blut. (In seiner Autobiographie nennt er sich auf Seite 42 „Protestant“ — Anmerkung des Verfassers.) Seine Mutter, ebenfalls eine kleine Sängerin an den Music Halls, war spanisch-irischer Herkunft.“
Der Vater ist Trinker und trennt sich schon ein Jahr nach Charles' Geburt von der Mutter; er stirbt, erst 37 Jahre alt, an Wassersucht. Sie verliert ihre Stimme, muß dreimal ins Irrenhaus, erlebt aber noch den Aufstieg der beiden Söhne (Charlie hat einen um vier Jahre älteren Bruder Sydney) in Amerika. Die zwei Buben sind in Armenhäusern, bei Verwandten und auf Schmieren aufgewachsen und zählen zu jenem erstaunlich zähen Proletariat, an denen die Filmgeschichte (Maurice Chevalier, Sofia Loren!) so reich ist. Dieser trüben Jugend ist Charlies amoralischer Schock (Seite 14: „Die Moral unserer Familie mit den üblichen Maßstäben zu messen wäre ebenso falsch, wie ein Thermometer in kochendes Wasser zu stecken“), vielleicht auch seine Glaubenslosigkeit zuzuschreiben. (Seite 402: Gespräch mit Rachmaninow, und die schroffe Bemerkung seines eigenen Sohnes: „Tennis bedeutet meinem Vater genausoviel wie anderen Männern Alkohol, Frauen oder Religion.“)
Langsam geht es aufwärts, über kleinere und größere Rollen in England nach Amerika (Seite 120: „Hier gehörst du her!“), über McSennet zu Keystone, wo die ersten Dollartausende zu rollen beginnen: die DickensGke3chicht'beginnt in die „Amerikanische Tragödie“ einzubiegen ...
Chaplins Buch enthält eine Filmographie, die uns erstmals erlaubt, das literarische Chaos zu sichten, aus erster Hand, denn hier verwischt und vermogelt der Autor nichts, ja er führt darin sogar den letzten Film an, „Ein König in New York“, seinen Rachefeldzug gegen die schnöde Behandlung durch seine Wahlheimat Amerika, den er im Text demonstrativ verschweigt.
Nach diesen seinen Angaben, an denen wir also nicht zu zweifeln haben, hat Chaplin in 79 Filmen gespielt und in einem weiteren nur Regie geführt, ohne zu spielen, in den meisten selbst den Stoff ersonnen und den Hauptdarsteller, Regisseur und Musiker gestellt. In dem einzigen Jahre 1914 zählen 35 Kurzfilme zur Firma Keystone, 1915 bis 1918: 15 zu Essanay, 1916/17: zwölf zu Mutual, 1918 bis 1923: neun zu First National und von da an neun zu Eigenproduktionen, die meisten davon zur United Artists, die Chaplin gemeinsam mit Mary Pickford, Fairbanks und D. W. Griffith gegründet und zu einem Millionenunternehmen und einem Unternehmen von Millionären, den ersten der Filmgeschichte, gemacht hat. Sechs Anthologien aus Chaplin-Filmen sind legitim und haben die Zustimmung des Schöpfers selbst: „Als Lachen Trumpf war“, „Charlie gegen alle“, „Charlie Chaplins Lachparade“, „Lachen verboten“, „Die Chaplin-Revue“ und „Das waren noch Zeiten“.
Einigen Überwissenschaftlern zum Trotz sind und bleiben die Filme bis 1921 Vorspiele, aus denen höchstens „Ein Hundeleben“ und „Zu den Waffen!“ herausragen. Das goldene Zeitalter der nicht bloß improvisierten und am Laufband produzierten, sondern „durchkomponierten“ Filme beginnt mit „The Kid“ 1921 und reicht über „Pilgrim“ 1923, „Goldrausch“ 1925 und „Zirkus“ 1928 (alle Stummfilme) in die beiden „Stumm-Ton-Filme“ (Filme mit Musik und bloß lautmalenden Gesprächsparodien) „Lichter der Großstadt“ 1931 und „Moderne Zeiten“ 1936.
Nun beginnt das Trauerspiel des Humoristen Chaplin. Der Pantomime, der Stummfilmkönig mit den unnachahmlichen Accessoirs (von Kopf bis Fuß auf Armut eingestellt) wird vom Tonfilm überrascht, an dessen totalen Sieg er jahrelang nicht glaubt. Er zaudert. Er weiß: hier geht es ums Ganze, nicht nur für den Film überhaupt, vor allem für ihn selber, oder wie es der Klappentext der Autobiographie zutreffend formuliert: „Es war nicht, daß er in dem neuen Medium (des Tonfilms) Glänzendes zu leisten außerstande gewesen wäre. Aber ein Tramp, der nicht mehr stumm litt und stumm triumphierte, sondern dazu seinen Kommentar gab, mußte das Einigende der Gestalt verlieren, in die gesellschaftlichen und ideologischen Kämpfe hineingezogen werden, Stellung nehmen und Stellungnahme provozieren.“
Die Zeit ist auch sonst aus den Fugen geraten und die Luft politisch schärfer geworden, so daß jedes Wort Chaplins auf die Waage gelegt wird.
Fürs erste schließt er ein Kompromiß und verulkt in zwei Filmen (siehe oben) das Geräusch und die Sprache, also den „Tod“ des Films. Aber der Konkurrenzproduktion, dem Vertrieb und dem Publikum genügt das auf die Dauer nicht.
Und da geschieht das Unheil: der stumm so Überzeugende fängt zu reden an. „Der große Diktator“, die Verspottung Hitlers und Mussolinis, ist zur Not noch im Getümmel der Zeit unterzubringen, man schreibt ja immerhin 1940 (die Nazis in Amerika waren natürlich auch damals schon nicht tatenlos).
„Monsieur Verdoux“ aber, eine Komödie um den Pariser Frauenmörder Landru, die wahrhaftig mit dem Entsetzen Scherz treibt, ist nicht mehr zu rechtfertigen. Zwar nennt sie Chaplin Seite 463 „den klügsten und brillantesten Film“, den er bisher gemacht habe, muß aber schon zwei Seiten darnach den „zynischen Pessimismus“ dieses Filmes zugeben. Die Zensur macht Schwierigkeiten gegen die unverständliche Pauschalanklage gegen die bürgerliche Gesellschaft (es brauchte dazu gar nicht des beginnenden McCartysmus in USA), und zum erstenmal geht zum großen Schmerz des Künstlers, aber im Grund sehr begreiflich — denn auch die Charlie-Maske ist zum erstenmal gefallen! — auch das Publikum nicht recht mit, das Chaplin und seine Filme bisher vergöttert hat.
„Rampenlicht“ 1952 ist Chaplins letzter Film in Amerika; es ist ein müder Film, in dem es noch da und dort blitzt und donnert, aber nicht mehr einschlägt.
„Ein König in New York“ 1957 ist bereits in Europa entstanden. Denn in diesen fünf Jahren hat sich allerhand getan: Chaplin hat nicht nur die Gunst der amerikanischen Regierung (im politischen Verfahren erfolgte wohl zuletzt ein Freispruch), sondern auch die Liebe des amerikanischen Millionenpublikums verspielt. Es ist wie ein Sinnbild: immer seltener taucht der Name Charlie auf; nicht nur bei Untersuchungen und Vernehmungen, sondern auch im Publikum heißt es von nun an immer häufiger „Charles“.
Chaplin war (ist) viermal verheiratet: mit Mildred Harris (1918 bis 1920). mit Lolita MacMurray (Künstlername Lita Grey, 1924 bis 1927, aus welcher Ehe zwei Söhne stammen), mit Paulette Goddard (1933 bis 1941) und seit 1943 mit der Tochter des verstorbenen Schriftstellers O'Neill, Oona, mit der er (bisher) acht Kinder hat.
Über die ersten drei Ehen ist in Chaplins Autobiographie überraschend wenig zu lesen, fast so wenig wie über seine gefürchtete Arbeitsweise im Atelier, über die beide sein Sohn Charlie viele mehr „ausgepackt“ hat. Sehr warm, herzlich und dankbar spricht er über Oona, aber auch nicht eben prüde über seine sonstigen erotischen Seitensprünge, dem freilich Seite 209 das Wort entgegensteht: „Im Gegensatz zu Freud glaube ich nicht, daß das Geschlechtliche das wichtigste Element in der Vielfältigkeit des menschlichen Verhaltens ist. Kälte, Hunger und die Schande der Armut beeinflussen wahrscheinlich die Psyche des Menschen viel mehr. Mein Sexualleben verlief zyklisch wie das eines jeden Menschen ... Niemals aber gewann es Herrschaft über mein Leben. Ich hatte schöpferische Interessen, die es zumindest genauso beherrschten.“
Trotzdem liefert sein letztes unglückliches Verhältnis zu einer hysterischen und kalt berechnenden Frau der Öffentlichkeit die eigentliche Handhabe zu seiner totalen
Der alte Zauberer gesellschaftlichen Diffamierung. Chaplin selbst will das heute noch nicht ganz wahrhaben und sieht die Ursache (Seite 476 f.) für den lautstarken Abfall seiner Gefolgschaft ausschließlich im Politischen und Unamerikanischen seiner Haltung in der McCarty-Zeit, und zwar:
Erstens: „Mein schlimmstes Vergehen war und ist immer noch, daß ich ein Nonkonformlst bin. Obwohl ich kein Kommunist bin, habe ich mich geweigert, mich denen anzuschließen, die die Kommunisten hassen... Zweitens stand ich in Opposition zum Komitee zur Untersuchung unamerikanischen Verhaltens. — Das ist schon von vornherein eine unehrliche Bezeichnung, elastisch genug, um sie jedem amerikanischen Bürger, der mit seiner ehrlichen Meinung zur Minderheit gehört, um den Hals zu wickeln und ihn damit zu ersticken. Drittens habe ich nie versucht, amerikanischer Bürger zu werden.“
Das bittere Kapitel schließt mit den bitteren Worten: „Diese Erklärung ist keine Entschuldigung. Als ich begann, dieses Buch zu schreiben, fragte ich mich, warum ich es täte. Es gibt viele Gründe dafür, aber der Wunsch, mich zu rechtfertigen, ist nicht darunter. Wenn ich meine Lage zusammenfassen soll, dann müßte ich sagen, daß ich mir in einer Atmosphäre mächtiger Cliquen und unsichtbarer Regierungen die Feindschaft einer Nation zugezogen und unglücklicherweise die Zuneigung der amerikanischen Öffentlichkeit verloren habe.“
Das ist weniger Dichtung als die halbe Wahrheit. So oder so — sie führten zu dem Auszug Chaplins und seiner Familie aus Amerika, das ihn groß gemacht und dessen Filmgeschichte er (wie Greta Garbo) groß gemacht hat. Dieser Exodus in Zorn und Trauer führt über England und Frankreich in die Genfer Seengegend von Vevey in der Schweiz, wo er in einer bisher zwanzigjährigen ungetrübten Familienidylle mündet. Immer wieder aufflatternde Gerüchte von einem filmischen Wiederkommen Chaplins (zuletzt in einem angeblich geplanten Film mit Sofia Loren) sind wenig glaubhaft.
Märchen sind sehr häufig heimlich revolutionär. Chaplins beste Filme sind Märchen. Chaplins beste Filme sind aber auch stumm und lassen dem freien Phantasie- und Gedankenspiel breiten Raum. Da sie zu reden angefangen haben, da der Tonfilm sie entzaubert hat, ist das Unentschiedene und Zwiespältige, das Aufreizende und Herausfordernde im Menschen Chaplin, das am Dichter der Stummfilme nicht hörbar gewesen ist, zum Vorschein gekommen.
Das und nichts anderes ist das eigentlich Tragische an dem großen Humoristen Charles Spencer, nein: Charlie Chaplin. Wer wirft den ersten Stein?
Chaplins Leben und Werk ebenso wie seine Autobiographie (informativ und zugleich lückenhaft, da und dort hinreißend und dann wieder enttäuschend) haben es bewiesen: Er ist „kein ausgeklügeltes Buch“, er ist „ein Mensch mit seinem Widerspruch“.
Es täuscht nur, wenn das Buch mit einer poetischen Weisheit und Gelassenheit schließt. Hinter der Stille brodelt es.
So aber schließt das Buch: „Von solchem Glück erfüllt, sitze ich manchmal bei Sonnenuntergang draußen auf unserer Terrasse und blicke über den weiten, grünen Rasen zum fernen See hinunter und darüber hinaus auf die Zuversicht einflößenden Berge, und in dieser Stimmung denke ich an nichts und freue mich ihrer großartigen Gelassenheit.“
Er selber, der Sechsundsiebzigjährige, hat diese Gelassenheit wohl noch nicht.