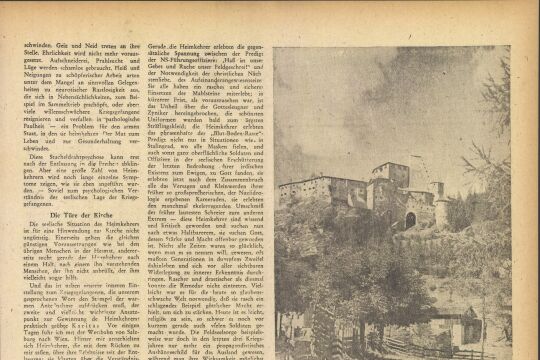Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Schwank von den Nazispiebern
Vieles ist von großer Treffsicherheit in Hochwälders volkstümlichem Schwank vom „Himbeerpflücker“, der vor zwei Jahren im österreichischen Fernsehen uraufgeführt wurde und nun im Grazer Schauspielhaus zum erstenmal auf einer österreichischen Bühne erschien. Vor allem das Vokabular verleiht der Satire auf die Nazispießer von Bad Brauning und anderswo ihren speziellen Reiz: es reicht von „Blut und Ehre“ bis zum „Atem der Geschichte“ und wie in lächerlichen Phrasen alle heißen, mit denen sich die kleinbürgerlichen Unentwegten in einen permanenten nationalen Rauschzustand gesteigert hatten, als sie noch weitermarschierten, bis alles in Scherben fiel. Nun sind sie reich geworden und zu neuem Ansehen gelangt, pflegen jedoch weiterhin die sogenannte „Kameradschaft“ und die ehrwürdigen alten Riten.
Das sind glänzende Voraussetzungen für eine spitze Satire, und auch der Handlungsverlauf, der sich aus der Ausgangssituation entwickelt, hat das Zeug zum Schelmenstück in sich: wie diese „Ehemaligen“ beim Auftauchen eines vermeintlichen „höheren Flüchtlings“, der immerhin seine sechs- bis achttausend Juden auf dem Gewissen hat, in klägliche Angst um die eigene gut unterspickte Haut geraten und den liebgewordenen Wohlstand doch nicht weltanschaulichen Fragen opfern möchten — auch nicht um ihrer Ehre willen, die Treue heißt —, und wie der umworbene Judenmörder sich nur als kleiner Dieb und Hochstapler entpuppt, den selbstverständlich die ganze Schärfe des Gesetzes treffen muß — das hätte schon einiges an grotesker und satirischer Wirkung hergeben können. Aber die große Chance wurde leider vertan. Zum einen von Hochwälder selbst und zum anderen vom Grazer Schauspiel. Der Autor schadet sich selbst und dem saftigen Vorwurf, indem er Typen und Verhaltensweisen allzu sehr massiert; dadurch begibt er sich der Glaubwürdigkeit: so wird das Lustspiel seicht, billig und plump. Die Grazer Aufführung (unter Rolf Hasselbrink) kehrt die Schwächen des Stückes noch hervor, anstatt sie zu kaschieren.
Auf der Probebühne des Grazer Schauspielhauses kann man derzeit ein hübsches kleines Werk des Franzosen Roland Dubillard sehen. Es heißt „Naive Tauben“ (im Original: „Naives hirondelles“), vermischt nicht nur Komik und Tragik, Wirklichkeit und Irreales, sondern auch Ionesco, Beckett, Tschechow, Paul Willems und Schehade. Und dennoch ist das Stück, in dem die Requisiten eine wichtige Rolle spielen und die Menschen an ihrer Kontaktarmut und am unerfüllten Dasein leiden, kein bloßes Stilpotpourri; es hat eine durchaus eigene, sehr wehmütige Melodie, die von der vordergründigen Lustigkeit nicht übertönt werden kann. — Solche Dinge sind im Deutschen kaum richtig wiederzugeben. Die Ubersetzung von Elmar Tophoven ist nicht geeignet, die Atmosphäre des Originals zu spiegeln. Beachtliches gelingt jedoch den jungen Schauspielern Maria Martina (der Tochter von Maria Kramer und Fritz Lehmann), Branko Samarovski und Herbert Rhom, die der Regisseur Peter Lotschak zu profilierten Leistungen führt.
Ein Kuriosum, wie es nicht allzu häufig vorkommt, ist der seit Jahrzehnten an der Grazer Oper engagierte Tenor Josef Janko, der viele Jahre hindurch einer der beliebtesten Sänger weit und breit war. Nun ist er siebzig geworden und hat zur eigenen Geburtstagsfeier seine Leibrolle, den Florestan in einer festlichen Aufführung des „Fidelio“ in der Grazer Oper gesungen. Es war ein Familienfest für die Grazer Musikfreunde und eine glanzvolle Bestätigung für Josef Janko, daß er an Vitalität unübertroffen ist und es an sängerischer Qualität noch immer mit manch Jüngerem aufnehmen kann.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!