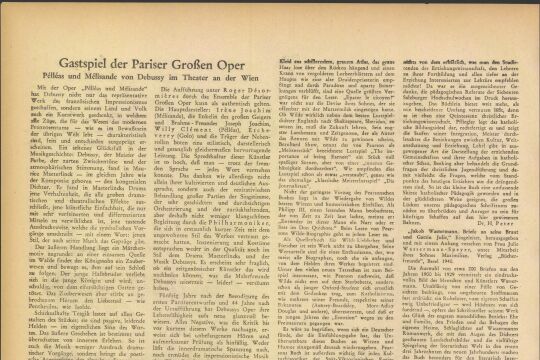Peter Truschner entwirrt in seinem Roman "Die Träumer" den Knäuel nicht, den er zuvor wickelte.
Peter Truschner vermag als Erzähler zu packen; das hat er mit seinem Debütroman Schlangenkind (2001) bewiesen. Auch mit Die Träumer bringt er das zuwege - doch Vorsicht ist geboten.
Ein spannendes Buch, zugegeben. Es beginnt mit dem Tod der Hauptfigur Robert. Gewalttätiges muss zuvor geschehen sein: "Robert ging nicht auf im großen Ganzen wie eine Prise Salz im süßen Brei. Verlöschen war kein Akt himmlischen Augenzwinkerns. Der Tod nahm es sehr genau, er war geradezu detailversessen, dabei jedoch ohne die für die Liebe zum Detail unentbehrliche Geduld." Truschner liebt deftige Vergleiche und ist auch detailversessen, doch wie sonst bei jedem mittleren Kriminalroman erfährt man die genaue Todesursache nicht.
Soziologe als Opfer
"Null" ist das erste Kapitel überschrieben, dann wird von Eins bis Zehn das unglückliche Leben Roberts in seinen letzten Jahren vorgeführt. Er ist Universitätsassistent, vermutlich Soziologe. Warum dieser Stand so oft herhalten muss, um in Romanen die Opferrolle zu spielen, ist eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Robert ist mit Iris verheiratet, die als Chefin eines Catering-Unternehmens erfolgreich ist. Obwohl die beiden sich auseinandergelebt haben, mögen sie sich immer noch. Robert verliert auf Grund einer unsinnigen Aktion seinen Posten; auch das wird nicht genau erzählt. Er trinkt Tinte und treibt ähnlichen Unfug, und der Autor hilft einem keineswegs dabei, aus alledem klug zu werden.
Robert macht sich an andere Frauen heran, vor allem an eine gewisse Kati, die ihm aber bald den Laufpass gibt. Ihm wird bewusst, dass er nirgends mehr willkommen ist, und er merkt, dass er nicht mehr so richtig mit kann, weder psychisch noch physisch. Besonders beklemmend die Szene, da er von arbeitslosen Ausländern aufgefordert wird, beim Fußballspielen mitzumachen.
Diese auf den ersten Blick belanglos wirkenden Desillusionserlebnisse sind eindrucksvoll und mit dem scharfen Blick für die Symptome der Erfolglosigkeit gestaltet. In diesem Punkt ist Truschner souverän, und manche dieser Partien könnte für sich bestehen. Sie wollen aber in einen Zusammenhang eingebettet sein, und da bekommt das Erzählkonzept Risse.
Bei Roberts Begräbnis taucht ein gewisser Voß auf, der vorgibt, der Witwe Klarheit über den ungeklärten Tod ihres Mannes zu verschaffen. Offenkundig weiß er mehr, aber niemand wird aus seinem Verhalten schlau. Klar wird nur, dass Robert nach dem Ausscheiden aus der Universität, das er Iris verschwieg, ein Doppelleben führte. Er gehörte einer merkwürdigen Vereinigung an, der Voß vorstand, eine kleine paramilitärische Organisation, deren strapaziöses Training Robert mitmacht; zunächst wird er gelobt, dann rausgeschmissen. Zugleich gibt es im Imperium des Herrn Voß eine andere Organisation, die sich in SOS-Kinderdorf-Manier um die Kleinen kümmert.
Spätestens da wird klar, dass man es keineswegs mit einem realistischen Roman zu tun hat, sondern gerade dort, wo man sich Klarheit wünschte, der Roman wie eine Fantasy-Story oder wie eine negativen Utopie wirkt. Die Stadt, die man zuerst mit Berlin, wo der Autor lebt, zu identifizieren geneigt ist, wird zur unüberschaubaren Megalopolis mit Slums. Rätselhafte Figuren treten auf, deren Handlungsweise genau so wenig erklärt wird wie die Roberts. Zu Erklärungen dieser Art sollte auch kein Autor verpflichtet werden, wenn aber immer wieder eine Lösung der Rätsel recht aufwendig in Aussicht gestellt wird, dann wünscht man sich doch, dass der Knäuel einmal entwirrt werden möge.
Recht platt wirkt die Geschichte von der Privatarmee des Herrn Voß, sehr unglaubhaft das Auftreten einer Figur namens Konrad, der einst Roberts Student war und nun dessen Untergang herbeiführt.
Keine Lösung
Was die Erzählstrategie betrifft, so irritiert der Umstand, dass manchmal aus der Perspektive der Frau, manchmal aus der Roberts erzählt wird. Während man über das Innenleben der Frau viel erfährt, bleiben die meisten Motive für Roberts Handeln opak. Das ist ein eklatanter Missbrauch der Autorität des auktorialen Erzählers.
So präzise oft die Einblicke in sehr spezifischen Situationen und so treffend oft einzelne kurze Dialogpartien sind - so wenig vermag die Gesamtkonzeption zu überzeugen. Auch über den Titel mag man sich den Kopf zerbrechen - eine Anstrengung, deren Ergebnis sehr ungewiss ist. Truschner ist geschickt im Umgang mit Metaphern, aber manchmal wird der Drang, alles zum Vergleich zu machen, doch zu viel. Dass Iris und Robert voneinander nicht lassen können, soll immer wieder plausibel gemacht werden. Vor seinem Ende dürfen wir Einblick in Roberts Verfassung nehmen, und selbst wenn man für Freiheit auch des derben Wortes im Bereich der Sexualität eintritt, fühlt man sich doch ein wenig irritiert: "Er wusste, dass er nicht mehr der Aktive war […], sondern dass er […] zu einem Medium geworden war, durch das hindurch ihre Sexualität sich ausdrückte. Kaum dass das Bild seiner Frau aufgetaucht war, ging es schon wieder unter im Fluss der Bilder und Gedanken, und sein Schwanz schrumpfte wie alles, das für Robert von Bedeutung war." Muss das sein?
Die Träumer
Roman von Peter Truschner
Zsolnay Verlag, Wien 2007
251 Seiten, geb., € 20,50
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!