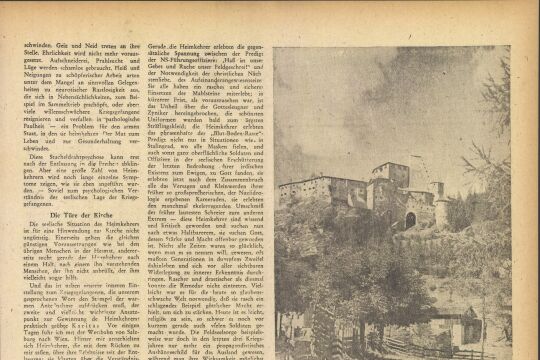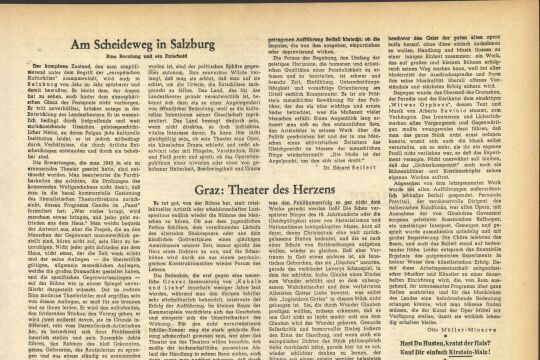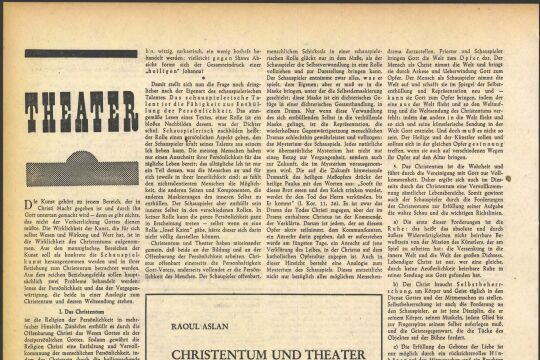Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Stephansspieler
Wien hat seit kurzem ein neues Theater. Man muß sich von der Vorstellung befreien, es handle sich bei der Gruppe von Schauspielern, die sich unter Leitung von Professor Kuchenbuch unter dem Titel „Stephansspieler“ zusammengetan haben, um einen Laienspielverein der von Zeit zu Zeit mit Mysterienspielen vor ein Publikum treten will. Die Stephansspieler sind Berufsschauspieler und verweisen auf die Frage nach ihrer künstlerisdien Eigenart auf ihre von anderen Theatern völlig verschiedene künstlerische Technik, die selbst wieder nidit bloße Technik ist, sondern von einer Art seelischen Erziehung des Sdiauspielers ihren Ausgang nimmt. Man kann diese ganze Richtung am besten als Übertragung der rhetorischen, auf das Religiöse gestimmten Technik der Ostkirche auf das Theater bezeichnen, als Anknüpfung an die große Tradition des metaphysischen Theaters. In den künftigen Plänen der Stephansspieler steht unter anderen Ibsen „Peer Gynt“ in einer neuen Übersetzung von Kollerics, Vondels „Luzifer“, Tagores „Postamt“, Hofmannsthals „Turm“, Peguys „Jeanne d'Arc“, Puschkins „Pest“, Strind-bergs „Advent“, Sophokles' „Ajax“ und andere. „Der verlorene Sohn“ wird — in der Übersetzung von Kamnitzer — als nächste Aufführung vorbereitet.
Als erstes Stück wählten sich die Stephansspieler die „Erste Legion“ des Amerikaners Emmet Godefry Laver y. Die Wahl war ein guter Griff, denn das Stück erweist sich heute genau so als echtes Theater wie vor einem Jahrzehnt, als es zum erstenmal in Wien im Theater in der Josefstadt über die Bretter ging. Allerdings, vieles hat sich gegenüber dieser Vorstellung vor einem Jahrzehnt geändert. Damals standen auf dem Programm die Namen von Schauspielern, die das Klangvollste darstellten, was Wien zu bieten hatte. Bassermann gab den Pater Rektor, Edthofer den Arzt, Attila Hörbiger den Pater Ahn. Ludwig Stößl die R~!!e des Monsignore. Diesmal weist das Verzeichnis der Mitwirkenden lang nicht so berühmte Namen auf; trotzdem hebt die Verstellung auf der Bühne der Stephans-spicVr sich besonders hervor: es ist einmal das Zusammenspiel des Ensembles, das so vortrefflich ist, daß es selbst in der Theaterstadt Wien stark auffällt. Es wäre deshalb schwer und auch ungerecht, einzelne Leistungen besonders hervorzuheben. Jeder Schauspieler gleicht einem Stein in einem Mosaik, das ohne seine Mitwirkung zerstört und lückenhaft wäre, eine Leistung, die wohl besonders auf das Konto der Regie Heribert Kuchenbuchs fällt.
Nicht nur die Art der Vorstellung hat sich gegenüber jener vor einem Jahrzehnt gewandelt, sondern auch wir Zuseher. Jahre namenlosen Grauens sind in diesem Jahrzehnt über uns hereingebrochen, Jahre, die unsern Blick für das Wesentliche geschärft haben. Wir stehen heute zu dem Problem des Stückes anders als vor einem Jahrzehnt, kritischer vielleicht. In diesem Stück geht es nicht sosehr um die Darstellung von Priestergestalten, sondern um die Darstellung des Priesterberufes, der uns in den verschiedenen Varianten gezeigt wird. Mit viel Zartheit und — mit viel Psychologie wird über die Schwierigkeiten des priesterlidien Berufes gesprochen, über die Nöte des Gehorsams, des Verzichtes, der Menschlichkeit. Aber an einem geht das Stück vorbei. Es zeigt den Beruf des Priesters, aber nicht das Wesen des Priestertums, die Berufung. Die Berufung als „alter Christus“. Es ist noch zuviel Psychologie in dem Stück und zu wenig charismatisches Christentum. Noch vor einem Jahrzehnt haben wir dies nicht bemerkt, erst der Krieg, der uns der nackten Wirklichkeit Gottes gegenübergestellt hat, hat uns hellhörig dafür gemacht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!