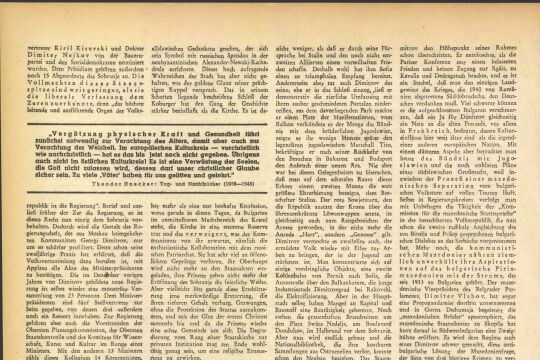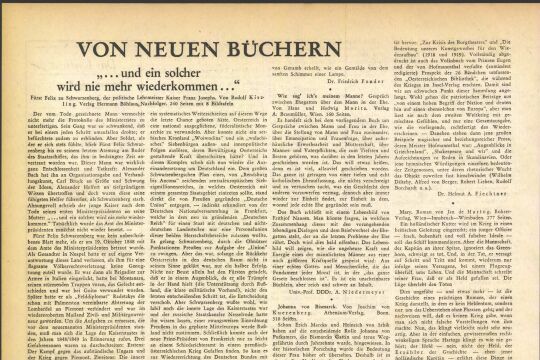Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die vorletzte Brücke
Da die „Brücke am K w a i“ in die Luft fliegt, ist auch der Zuschauer zerschlagen und zerstört. Man verläßt den in jeder Hinsicht außerordentlichen, 2 Stunden 46 Minuten lang von Szene zu Szene jagenden amerikanischen Film (mit englischem Produktionsstab) vorerst einmal nervlich erschöpft und geistig verstört. Erst nach Stunden, vielleicht nach Tagen mag sich bei vielen die heilende Wirkung einstellen. Denn es ist eine Kur, die da getrieben wird, eine Elektroschockkur gegen etwas, was bezeichnenderweise der Truppenarzt am Schlüsse Wahnsinn nennt. Und damit meint er nicht nur den Krieg, sondern viel mehr.
Es beginnt mit der verdammt korrekten Auslegung der Genf-Haager Vereinbarungen durch den britischen Oberst in japanischer Gefangenschaft, der für seine Offiziere auch im Dschungel Heraushalten aus der Arbeitspflicht fordert und dafür mit imponierender Zivil- und Militärcourage Mißhandlungen erduldet. Es setzt sich fort in des rehabilitierten Obersten sonderbarem Entschluß, die den Japanern taktisch so notwendige Flußbrücke nun doch mit allen britischen Arbeitsreserven — einschließlich Offizieren und Verwundeten! — zu bauen; einmal, um die gelockerte Disziplin der Truppe wieder aufzufangen, und dann, um den Japanern mal zu zeigen, wie britische Hirne und Hände bauen. Vielleicht, vielleicht schlummert in irgendeinem Winkelchen seines Herzens auch noch der Wunsch, ein auch im Frieden dauerndes Werk, eine echte „Brücke“ zu bauen. Aber, so meint der Film, diesen ihren Sinn durfte der Krieg nicht erkennen: er mußte sie wieder zerstören. Dies besorgt ein britischamerikanischer Störtrupp zur Stunde, da der Oberst in seine Traumbrücke als ein Ding an sich nunmehr richtig verliebt ist. So sabotiert er zuerst die Sabotageaktion seiner Landsleute, löst aber dann doch, sich seiner „nationalen Pflicht“ besinnend, sterbend den Auslösehebel des Zündkastens aus. Rauch, Trümmer, Wahnsinn. Aus.
Nicht nur im Titel, im fatalen Requisit der Brücke, bietet sich von selbst ein Vergleich zu dem unvergeßlichen Partisanenfilm „Die letzte Brücke“ an. Er fällt — rein thematisch — zugunsten des österreichischen Films aus. Der Opfertod der Aerztin in ihm ist sinnvoller, er kann wirklich als „letzte Brücke“, als letzte versöhnliche Möglichkeit aufgefaßt werden. Die am Kwai dagegen ist eine vorletzte, eine teuflische, grauenhafte Brücke, auf deren „gellende Lache“ „Grabesstille folgt“. Es kann nur auf Umwegen erschlossen werden, daß ihr wieder Vernunft und Erkenntnis folgen.
Formal ist „Die Brücke am Kwai“ makellos ber k4enrtenL,wie..eine Fonfane-Rallade ,(merkwürdiger-) Anklang: ;„Die Brück', am Tay“), männlich-hart, stellenweise hinreißend. Produzent (Sam Spiegel, der Wiener), Regisseur (David Lean) und eine Reihe von Darstellern, voran Alec Guiness in der pathologischen Studie des Obersten, tragen sich, mit sieben Oscars ausgezeichnet, in die Geschichte des Films ein. Noch am Rande fallen auf: der wohl seit Anton Karas' Zither-Gespenstersonate im „Dritten Mann“ erregendste Einsatz des (gepfiffenen!) River-' Kwai-Marschliedes, die subtile Nuancierung britischen und amerikanischen Ehrbegriffes (wir haben europäische Parallelen dazu), das unheimliche asiatische (im Grunde gleich wahnsinnige) Gegenspiel in der starren Maske Sessue Hayakawas u. a.
Ein großer Film von unantastbarer charakterlicher Hakung, der auf klinischen Umwegen Kriegs-v.nd Kommißgeist-Gegnerschaft predigt. Seine Schwäche: die verdeckte, fast verschrobene Methode. Man könnte das alles wahrscheinlich einfacher und damit überzeugender sagen.
Anna Magnani und Anthony Quinn wären ein Gespann, ein Sprengtrupp, der mehr als Brücken in die Luft jagen könnte. Ihre seelischen Eruptionen sind auch Sehens- und hörenswert, George Cukors Film „Wild ist der Wind“ leider nicht ganz. Die interessant anhebende Story, Verpflanzung einer Vollblutitalienerin in das fremde Klima einer amerikanischen Farm, wird im weiteren Verlauf leider mit einer bedenklich verbogenen Moral und einem stellenweise unerträglichen Opernpathos aufgeladen. Es reichte noch zu einem „Silbernen Bären“ in Berlin und einem „Goldenen David“ in Italien für die Magnani; dem Regisseur gebührte ein blecherner Georg.
„Im Prater blüh'n wieder die Bäume“ ist ein österreichischer Film nach der schmackhaften Bühnen-„Sachertorte“; ein Film des Zauberlehrlings Hans Wolff, der seinem Meister Willi Forst manche Beschwörungsformel abgelauscht hat, die guten Geister aber letztlich doch nicht bändigt — es wird von Szene zu Szene wässeriger .,. Einige Frivolitäten und an einer Stelle auch eine wohl nicht unbeabsichtigte taktlose politische Anspielung schienen uns entbehrlich. Hannerl Matz ist anmutig wie kaum zuvor. Auf ihr überzeugendes Comeback in anspruchsvollerer Rolle hoffen wir hartnäckig weiter.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!