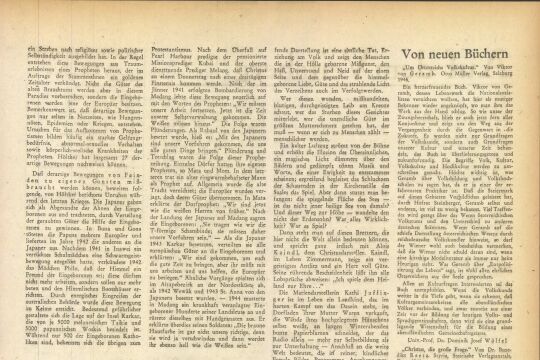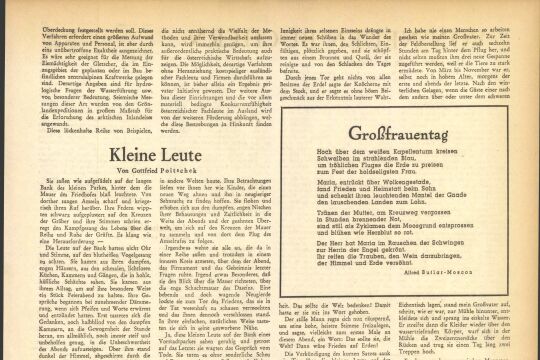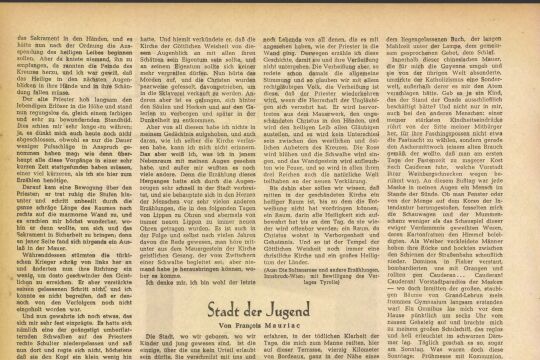Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Und was ist hinter dem Bretterzaun?
Die vier, die in einer finsteren südlichen Nacht auf urwelttier-ähnlichen Lastkraftwagen im Fünf- Kilometer-Tempo Las Piedras verlassen, um gegen hohe Belohnung Nitroglyzerin 500 Kilometer weit zu einer brennenden Oelquelle zu bringen, sind Verlorene; von der Uhr ihres gestrandeten Lebens abgelesen vielleicht schon vor der „Himmelfahrt", noch deutlicher aber auf der Fahrt selber, auf der sie Unvorstellbares erleben müssen. Alles scheint sich gegen sie zu verschwören: Nadelkurven, Steinlawinen, morsche Brücken, noch mehr aber die Angst, die alles Zufällige von ihnen abstreift und das Kreatürliche so wie den Knochen unter dem Fleisch bloßlegt: Der scheinbar Starke wird zum Feigling, der Kleine wird groß, der Stumpfe bleibt stumpf, nur ein jüngerer harter Knochen scheint das Rennen zu machen. Hinter sich die zerfetzten Reste des einen Wagens und seiner Insassen, in seinem eigenen Auto die Leiche seines Mitfahrers, den er fast gemordet hat, fährt er als Retter und Sieger bei der brennenden Quelle vor. Aber was verloren ist — meint der Film — ist verloren. Auf der Rückfahrt torkelt er zu denselben Radiomusikklängen, zu denen, man in Las Piedras walzend seinen Sieg feiert, in den Abgrund. Er w i r d damit,'er ist somit richtig „geworfen", wie einer der köstlich labenden Fachausdrücke jener geistigen Richtung von gestern lautet, die das Leben als einen Schritt vom Nichts zum Nichts sehen.
Den geistigen Bodensatz dieses Filmes — „Le Salaire de la Peur", „Lohn der Angst" —, der mit internationalen Preisen, Preiseren und Preisesten ausgezeichnet wurde, stellen, abgesehen von der anderen Vorbildern abgeguckten und daher nicht mehr ganz bezeichnenden Notdurft- Szene, etwa folgende drei Szenen dar:
Die erste. Wohl mit Absicht gerade den Schwächling, den Gangster-Mitfahrer Jo, läßt der Film sterbend so etwas wie die große Frage des linken Schächers am Kreuze tun. Von. Jugenderinnerungen gequält und beglückt, fragt er, halb schon drüben, seinen Freund Mario — das ist jener harte Knochen, der am längsten durchhalten wird:
„M ario, was ist hinter dem Bretterzaun?"
Mario (zischend, zynisch frohlockend): „N i c h t s.“
Die zweite Szenen mehr den Corpus als den Spiritus des Films betreffend, stammt gleichfalls aus der letzten Stunde Jos; es ist keine Frage, eher eine hellwache Erkenntnis, wenn er plötzlich im Fieber meint, hier rieche es nach Verwesung…
Die dritte Szene ist für die geistige Untiefe und die leichtfertigen Metaphern des Films vielleicht am bezeichnendsten. Dem königlichsten, strahlendsten, lebensbejahendsten (still und weise), jubelndsten der Wiener Strauß-Walzer wird in diesem fremdländischen Film die zweifelhafte Ehre zuteil, den letzten der vier Geworfenen in die Grube zu geigen. Unter den Klängen der „Schönen, blauen Donau" saust der Lastwagen über den Rand, birst das Gestänge, explodiert der Tank, züngeln die Flammen, gellt sozusagen das Lachen, „auf welches Grabesstille folgt".
Vielleicht lohnte sich gerade noch ein verzweifelter Versuch, auch solchen Filmen noch ein Restchen Wert und Notwendigkeit abzugewinnen? Etwa mit dem Blick auf so viel Verlorenes in unserer Zeit? Mit der Pflicht nämlich, diese wenigstens ins Blickfeld von uns „geborgenen", „satten“ Christen zu rücken? Dies aber verwehrt, meine ich, diese neue „Manon", dieser Film, an dessen Anfang ein trostloses animalisches Vegetieren, in dessen Mitte das Fressen und Gefressenwerden und an dessen Ende der Abgrund steht, von sich selbst aus.
Bleibt also der artistische Bluff eines brillierenden, stellenweise — zugegeben — beklemmende Effekte erzielenden Depressivstiles, der allerdings förmlich herausfordert, die Frage zurückzugeben, was denn nun wirklich hinter den schimmernd-verwesenden Fassaden solcher Filme „hinter dem Bretterzaun", sei.
Die Antwort hat Mario.
Aber vielleicht ist noch hinter der „Gläsernen Mauer" Rettung?
Der ungarische Flüchtling Peter ist am Abend als blinder Passagier auf einem Schiff mit DPs nach New York gekommen. Die Gesetze geben ihm eine Chance. Findet er bis 7 Uhr früh seinen amerikanischen Freund Tom — er weiß von ihm nur eines: vor Jahren Klarinettist in einem Lokal am Broadway —, so wird der für ihn bürgen und Peter wird bleiben können- Wenn nicht… Es wird eine lange, bange Nacht des, Suchens, des Sichverlierens, der Verzweiflung. In letzter Minute flüchtet Peter, von der Polizei verfolgt, auf den interterritorialen Boden des großen neuen UNO- Gebäüdes mit seinen gläsernen Magern. Zwar gähnt auch hier der große, für ihn zuständige, Konferenzsaal in seelenloser Leere, zwar drängt es auch ihn, wie den Korsen Mario in „Le Salaire de la Peur", im 37. Stockwerk ganz, ganz nahe an den Abgrund — aber hier tönt kein „leichenbitterer" Strauß-Walzer, hier ist, ohne Ironie, Lohn der Angst: Umkehr, Hilfe, Leben.
Der amerikanische Film „D ie gläserne M a u e r" nimmt den großartigen Anlauf des seinerzeitigen englischen Films „Odd man out" („Der Gehetzte"), springt aber zu kurz und landet fast im Reißer. Er ist trotzdem ein beachtenswerter Film von starkem Vorwurf, sauberer Gesinnung und: freimütiger Selbstkritik. Denn wenn die gläserne Mauer der Bürokratie — so verstehen wir wohl die Moral der Geschieht’ — einmal birst und der öde Konferenzsaal sich mit Leben, Mitleben und Mitleiden füllen sollte — dann, dann vielleicht ist noch für die Menschen und die Völker Rettung hinter der gläsernen Mauer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!