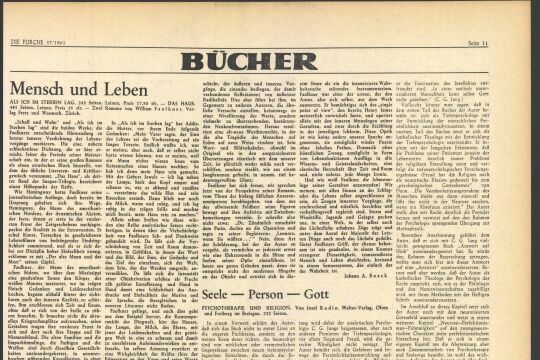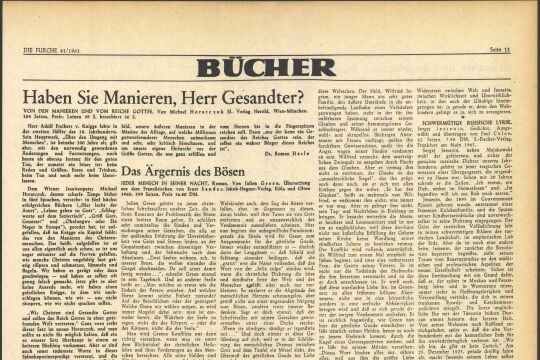Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erziehungsroman des Gentlemans
DIE SPITZBUBEN. Von William F a u 1 k n e r. Roman. Fr* * & Wasmuth-Veriag AG, Zürich, 1963. 327 Seiten. Preis 163.30 S.
Lucius Priest, ein elfjähriger Junge aus gutem Haus, erliegt den Verlockungen, die ihm aus der einwöchigen Abwesenheit von Eltern und Großeltern erwachsen. Er hört auf die Einflüsterungen des väterlichen Chauffeurs Boon Hogganbeck, eines Indianerbluts, der ihn zu einer Reise mit dem Automobil des Großvaters nach der großen Stadt Memphis bewegen kann. Onkel Ned, ein altes Negerfaktotum, vermag sich ebenfalls in das Auto einzuschmuggeln, und zu dritt bestehen sie die abenteuerliche und beschwerliche Reise. Man schreibt das Jahr 1905. In Memphis steigen sie in einem zweifelhaften Etablissement ab, und die Verwirrungen beginnen. Onkel Ned, ein Pferdenarr, tauscht das Automobil gegen ein Rennpferd; ein Sieg soll das Auto und reichlichen Gewinn dazu wieder einbringen. Das Rennen reitet und gewinnt Lucius. Er tut Unrecht, besteht aber letzten Endes doch. „Ein Gentleman kann alles überleben. Er kann allem die Stirn bieten. Ein Gentleman nimmt die Verantwortung für seine Taten auf sich und trägt die Bürde ihrer Folgen, sogar wenn er selbst sie nicht veranlaßt hat, sondern nur eingewilligt hat, nicht nein gesagt hat. obwohl er wußte, daß er's hätte tun sollen.“
Das ist in den Hauptzügen und in seiner abschließenden Tendenz der Inhalt des letzten Romans von William Faulkner: „Die Spitzbuben.“ Obwohl Faulkner den Autor Hemingway nicht übermäßig schätzte und schon gar nicht seinen Roman „Uber den Fluß und in die Wälder“, drängt sich ein Vergleich auf: Beide Schriftsteller schrieben in diesen Büchern das Märchen eines idealen Lebensbildes. Hemingway suchte es an einem fast schon zu Ende gelebten Leben darzustellen, Faulkner an einem, das erst am Beginn steht. Hemingway schildert die vollkommene Entenjagd, die vollkommene Geliebte, den vollkommenen Barmixer und die vollkommene Kulisse, das entkitschte, weil durch den Winter touristenentleerte Venedig. Faulkner hingegen baut zum letztenmal das Land seiner meisten Romane und Geschichten auf, das Land des „langsam durch Flachland fließenden Wassers“, das Land der Chickasaw-Indianer, mit den altbekannten Namen der Sartoris, der McCaslins, der Sutpens (Boon Hog-ganbecks Vorgeschichte ist im „Bär“ nachzulesen); er baut es in seinem letzten Roman auf aus der Erinnerung eines Großvaters, der seinem Enkel erzählt, wie es damals war, um die Jahrhundertwende. Als der Wald noch bis zu den kleinen Städten reichte, als der Bär noch gejagt wurde, ein Auto noch ein Abenteuer war und ein Pferd noch die Bewährung bedeutete. Durch das jugendliche Alter des Helden sind die Rassen- und Standesunterschiede scheinbar aufgehoben; einigermaßen gleichwertig ziehen die drei in das Abenteuer. Dennoch ist es der junge Weiße, der letztlich die Entscheidung trifft, die willentliche, und damit in das Schicksal eingreift.
Bei der Interpretation von letzten Werken entgeht man nie ganz der Gefahr, sie als geistiges Erbe und Testament zu betrachten. Diese Gefahr ist bei den „Spitzbuben“ besonders groß, trägt dieser heitere Schelmenroman doch eine Menge von autobiographischen Zügen. Faulkners Vater besaß, wie der des jungen Lucius, einen Mietstall; Faulkner selbst hat sich einmal ein wildes Pferd gekauft und es gezähmt; die wehmütigen Erinnerungen an das alte Indianerland sind seine eigenen.
Die Grundelemente des Romans sind aus dem Schaffen Faulkners bekannt. Er schrieb auch hier wieder über das, was er sein „vertrautestes Werkzeug“ nannte: über das Land, in dem er aufgewachsen ist und über die Menschen dieses Landes. Ein Weißer, ein Roter und ein Schwarzer tragen die Fabel. Alle drei sind freie Männer, denn ein Gentleman verabscheut die Sklaverei. Der Fluch des Südens, hat Faulkner einmal definiert, „besteht in der Sklaverei, ein untragbarer, menschenunwürdiger Zustand — niemand darf zum Sklaven erniedrigt werden —, und der Süden muß mit diesem Fluch fertig werden und es wird ihm auch gelingen, wenn man ihm Zeit läßt“. Aber es ist der junge weiße Gentleman, der die Entscheidung fällt für alle drei; der rote und der schwarze Mann werden hier nicht in einem äußeren Abhängigkeitsverhältnis gezeigt (es sei denn, daß sie Angestellte des Hauses sind), sondern in einem geistigen, menschlichen und moralischen.
Die Möglichkeit, dies unter Beweis zu stellen, schafft Lucius das Pferd. Wohl ist es Ned, der den Pferdeverstand hat und ihm sagt, was er zu tun hat, aber Lucius bändigt es und wächst mit seinem Sieg in die Verantwortung hinein. Zu seiner Erzählung „Gefleckte Mustangs“ hat Faulkner die Erklärung gegeben: „Mit den Pferden zeigte ich, daß der Mann selbst in einer Gesellschaft, in der der ständige Zwang zur Anpassung herrscht, noch immer durch die Chance, ein Pferd für drei Dollar zu erwerben, dazu bewogen werden kann, gelegentlich aus der Reihe zu tanzen. Und dies halte ich für ein gutes Zeichen. Ich hoffe, daß der Mann in unserer Zeit immer dazu bewogen werden kann, gelegentlich ein Pferd für drei Dollar zu kaufen.“ Der elfjährige Lucius verkörpert in diesem Roman jenen Kavaliersgeist des Südens, dem der gar nicht so verborgene Romantiker Faulkner selbst sein ganzes Leben lang angehangen hat.
Faulkner hat sein letztes Bild vom Menschen humorvoll gezeichnet. „Es gibt keine genaue Unterscheidung zwischen Humor und Tragik, doch in gewisser Weise ist selbst die Tragödie ein Tanz auf einem Drahtseil zwischen dem Lächerlichen, zwischen dem Bizarren und dem Schrecklichen. Der Schriftsteller benutzt den Humor möglicherweise als Werkzeug, er versucht über Menschen zu schreiben, über den Menschen, über das menschliche Herz, und deshalb benützt er jedes Werkzeug, von dem er glaubt, daß es für seinen Zweck geeignet ist, um das Bild zu beenden, das,,er &n Augenblick zu malen versucht. Er greift zum Humoristischen, zum Tragischen, ebenso wie er zum Gewalttätigen greift. Es sind alles Werkzeuge für ihn, doch der Humor ist ein unauslöschlicher Teil des menschlichen Lebens.“ Wenn nun Faulkner seine Altersparabel von der Menschwerdung eines Südstaaten-Gentlemans in die Zeit seiner eigenen Kindheit verlegt und als Schelmenstück darstellt, das erst durch die Bewältigung zum Ansatzpunkt einer Existenz wird, bedeutet dies nichts anderes, als, daß er die Wirklichkeit zum Märchen, zum idealen Wunschbild verfremdet hat.
Der Roman scheint bei oberflächlicher Lektüre leichter als er ist, durch die Komposition (der Großvater erzählt) absichtsloser und zufälliger, als es die genauere Analyse dann erweist. Denn all die Abschweifungen, die scheinbare Disproportion im Handlungsablauf (Herausarbeitung von Details und Außerachtlassung wichtiger Fabelelemente), der stockende Sprachduktus erweisen sich letztlich als subtil gestalteter Erinnerungsprozeß eines alten Mannes, der nur mehr das seinem Enkel weitergibt, was für ihn wichtig geblieben ist aus jenen acht Tagen seiner eigenen Kindheit, und das, was er glaubt, hievon seinem Zuhörer als wichtig und entscheidend weitergeben zu müssen. Halb als Erinnerung, halb als pädagogische Erzählung ist dieser letzte Roman William Faulkners geschrieben. Und daß dies auch in der deutschen Fassung sichtbar und merkbar wird, verdanken wir der ungewöhnlich einfühlsamen Übertragung durch Elisabeth Schnack, die eine Form gefunden hat, die vergessen macht, nicht das Original, in der Hand zu haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!