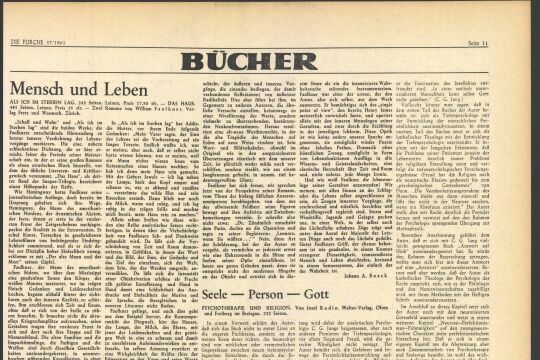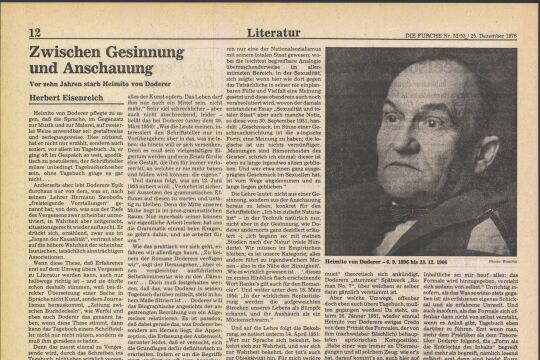Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mord an der Sprache?
William Faulkner sagte einmal, daß es nicht auf die Form der Aussage ankomme, daß ihr Inhalt allein entscheide. Unter allen Dichtern des gegenwärtigen Amerika ist es allerdings gerade Faulkner, der sich — die schwierige Struktur seiner Romane zeigt es — am meisten mit Formproblemen befaßte. So war es zu verstehen, daß sein Name wiederholt in den Diskussionen fiel, die auf der jünsten Dreiländertagung der „gruppe junger autoren“ in Linz den Lesungen und Referaten folgten. Hier zeigte es sich, daß sich die Generation der schreibenden Fünfundzwanzig- bis Fünfunddreißigjährigen sehr wohl über die Form ihrer Aussage Gedanken macht. Das bewiesen die Arbeiten und, fast noch mehr, die Hitze und mitunter sogar Heftigkeit, mit der diese Aussagen debattiert, bewies der Ernst, mit dem auf das Vorgetragene eingegangen und an die dahinterstehenden allgemeinen Probleme der Dichtung herangegangen wurde.
Mit dem Namen Faulkner — und mehr noch mit Joyce — verbindet sich für viele der Gedanke an die Zertrümmerung des gewohnten Satzgefüges, an einen „Mord an der Sprache“. Man denkt an seine seitenlangen Sätze, die mehrfach Subjekt, Prädikat und Objekt wechseln und ungeordnet erscheinen. Wenn aber der Sprache das Wort geredet wird, sollte eines bedacht werden: daß unter Sprache nicht die lediglich grammatikalischkorrekte Sprache von Schüleraufsätzen zu verstehen ist. Dem Gedanken an den „Mord“ aber scheint sich stets ein zweiter liebend gern anschließen zu wollen: das Argument des: na ja, das habe sich vielleicht ein Faulkner, ein Joyce, ein Proust, ein Broch erlauben können. Es bliebe nun zu überlegen, ob sie nicht erst dadurch ein Faulkner, Joyce, Proust, Broch wurden, daß sie das Neue wagten, daß sie sich eben „einiges mit der Sprache erlaubten“.
Das Nichtgelesenhaben ist kein Alibi für Stilnachfolge. Der mit Formproblemen ringende junge Autor hat die Pflicht, die großen Werke der Weltliteratur nicht nur zu kennen, sondern sie intensiv zu studieren, den „Griff in den Staub“ ebenso wie den „Mann ohne Eigenschaften“. Denn wenn er nur irgendwie wirklidi in seiner eigenen Zeit lebt, werden sich von selbst Stilelemente dieser Zeit in seine Zeilen drängen. Die Handhabung des Stils, der Form, der Gestaltung überhaupt aber ist eine Frage der Wahrhaftigkeit, der Entsprechung von Gehalt und Gestalt. Sie muß daher eine sehr bewußte Angelegenheit bleiben. Um sprachlich weiterführen zu können, ist auf dem zuletzt Erreichten aufzubauen. Und dieser Baugrund muß gekannt werden wie das Stück Erde vor dem eigenen Haus. Sonst verpulvert die Schöpferkraft, geht ins Leere, erschöpft sich im nochmaligen Schaffen dessen, was schon vor Generationen gültiger erreicht wurde. Aber nicht nur um weiterzuführen, auch um Eigenart zu entfalten ist die Kenntnis der großen Namen der Literatur nötig; denn nur über sie führt der Weg zur Erkenntnis des eigenen Wesens und damit zur eigenen Aussage, die die Zeit betrifft.
Alle Dichtung ist entweder Beschwörung, Wortformel oder Mitteilung von etwas Existenten: wobei dieses Existente der Außenoder der Innenwelt angehören kann. In diesem Sinne gibt es auch Hesses Glasperlenspiel wirklich, wird es tatsächlich gespielt. Der Wesensunterschied zwischen Dichter und Reporter liegt nun keineswegs darin, daß der eine über Bestehendes der Innen-, der andere
über Bestehendes der Außenwelt berichtet. Der Wesensunterschied liegt in der Form der Aussage, in der Sprache. Der Dichter mag sie hart in die Schule nehmen; dann geschieht es aber bewußt und ist notwendig. Der Reporter zersetzt sie und höhlt sie aus. Beider Aussage hat eine Form: die eine bewältigt, verwandelt die Substanz, die andere erfaßt sie nicht; die eine umschließt sie, die andere schließt sie aus. Daher darf man, hat man den Begriff des Reporters in dieser Richtung festgelegt, in Mailer oder Jones nicht Reporter sehen, auch wenn ihre Sprache unvollkommen ist, auch wenn sie ihre Inhalte nicht immer gestaltet haben. Ihre primäre Absicht ist es, zur Zeit zu sprechen. Und wer schreibt, um unmittelbar zur Zeit zu sprechen, ist auf jeden Fall mehr als Reporter.
Welche Sprache aber muß man reden, um zur Zeit zu sprechen? Doch wohl immer noch die Sprache, die dem Inhalt angemessen ist. Das scheint eine Binsenweisheit. Und doch treten uns heute viele sprachlichen Erzeugnisse in nahezu derselben Form entgegen, so, als hätten sie alle nur einen Inhalt.
Wenn aber die dichterische Aussage an ihrer Oberfläche ungehobelt, dissonant, abgehackt erscheint — wie bei einigen der heutigen Autoren —, wird es nicht immer angebracht sein, von einem „Mord an der Sprache“ zu reden. Es ist möglich, daß gerade diese Aussageform dem längst nicht mehr idyllischen Gehalt entspricht. Es ist möglich — und Gottfried Benns eben jetzt erschienene „Destillationen“ werden das aufs Neue bestätigen —, daß es sich um reduzierte, „destillierte“ Sätze handeln kann, vielleicht sogar um neue Sprachkunstwerke, um den reinen Niederschlag des Wesens.
Schon bei Shakespeare unterscheiden sich die Personen zuallererst durch ihre Sprache, im „Goldenen Vlies“ reden die Bewohner von Kolchis anders als die Thessalier. Das ist nicht Zufall, sondern Wissen um den Zusammenhang von Wort und Wesen.
Der Autor dagegen, der weniger dichtet als verdünnt, der sein Minimum an übernommener Einsicht in übernommenes Versgewand schnürt, der die Form nicht erfüllt, nicht ausfüllt, sagt gar nichts aus. Die Erfüllung von Formbedürfnissen, die dein Inhalt nicht adäquat sind, ist Selbstbefriedigung. Angesichts dieser hohlgewordenen Form — nur in der Malerei können autonome Formen, die sich selbst setzen und selbst bedeuten, bestehen — scheint sogar ein „Mord an der Sprache“ nicht unbedingt verwerflich. Wenn in diesem „Mord“ Vollendung liegt, wenn er das Opfer bedeutet, dem die Auferstehung der Sprache, das “Finn again is awake“ folgt.
Die Aussage über das Grauen eines Elendsquartiers muß' so „unmöglich“ sein, wie das geschilderte Objekt unmöglich sein sollte. Die Aussage über die Wildheit einer Katze muß katzenhaft geschmeidig sein und nicht zu verwechseln mit der ruhigen und gemessenen Schilderung einer klassischen Säule. Die Aussage muß Ausdruck sein. Das Wort darf nicht bloß Name und Klang bleiben (denn dann wäre es Schall und Rauch). Es muß Geruch, Geschmack, Farbe annehmen, es muß sichtbar werden, greifbar, man muß seinen Finger darauflegen und seinem Verlauf entlangfahren können wie dem einer Birkenrinde.
Das Wort muß Fleisch und Blut annehmen, um seinen Platz in unserem Leben zu gewinnen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!